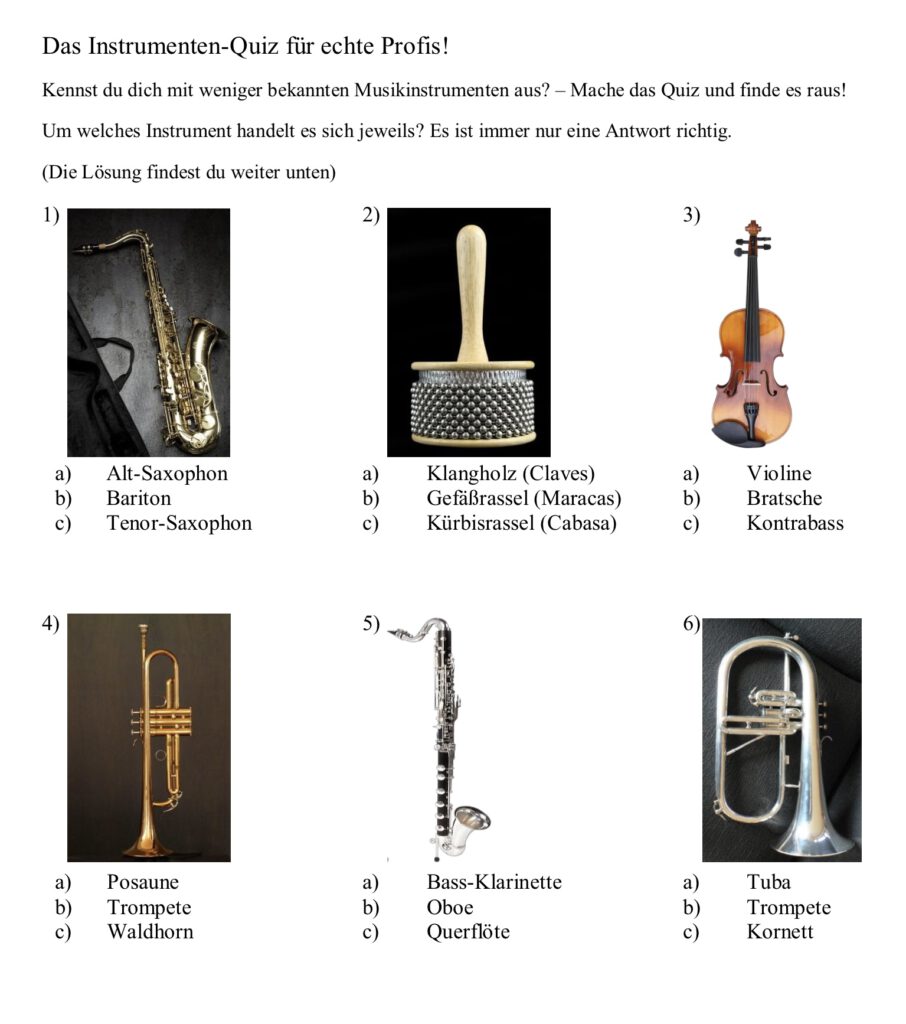An bayerischen Schulen werden seit guten sechs Wochen von Schülerinnen und Schülern regelmäßige Covid-Selbsttests durchgeführt. Davon betroffen sind alle Schularten – von der Grundschule bis zu weiterführenden Schulen. Die Idee dahinter ist, Infektionen frühzeitig zu erkennen, sodass Ansteckungen verhindert und die Normalität langsam in die Schulhäuser zurückkehren kann.
Nach der Ankündigung, es solle Schnelltests auch an Schulen geben, herrschte große Verunsicherung seitens von Schüler*innen, Lehrer*innen, aber auch Eltern und Erziehungsberechtigten. Jede Partei hatte dabei andere Bedenken, Fragen und Sorgen, ausgelöst von diesen Schnelltests. Gerade Eltern von jüngeren Kindern hatten Sorge, ihre Mädchen und Buben seien noch gar nicht in der Lage, sich ein Stäbchen in die Nase zu führen, um eine Probe für die Pufferlösung zu entnehmen und diese dann auf den Teststreifen zu träufeln. Diese Bedenken waren und sind durchaus nachvollziehbar.

Genauso ist ebenfalls die teilweise Überforderung seitens der Lehrerkollegien und Schulleitungen verständlich gewesen. Für eine solche Testung sind Lehrkräfte nun einmal nicht ausgebildet worden. Außerdem bedeutet es zusätzliche Arbeit und Verantwortung. Und dann war da noch die Frage, was mit Schüler*innen passiert deren Test positiv ausgefallen war. Lange herrschte Unklarheit (vor allem unter den Schüler*innen) über die Regelungen, die gelten, da aus Sicht der Heranwachsenden meist zu wenig über die aktuellen Beschlüsse und Regelungen gesprochen und diskutiert wurde. Meist waren die aktuell geltenden Regeln auch seitens der politischen Entscheidungsträger wenig transparent, sodass man sie schlecht nachvollziehen konnte.
Nun, nach ein paar Wochen, kann man durchaus sagen, dass sich eine Routine entwickelt hat. Man hat sich an dieses Prozedere gewöhnt. Nachdem es zuerst zu einem großen, logistischen Aufwand kam und die Beteiligten erst einmal den Ablauf lernen mussten (was häufig mit Hilfe eines Videos des jeweiligen Test-Herstellers geschah), hat sich alles aber eigentlich gut eingependelt.
Ein typischer Ablauf an einem Testtag sieht in der Regel so aus, dass die Lehrkraft die nötigen Test-Kits mit in das Klassenzimmer bringt, in dem sie in der ersten Stunde unterrichtet. Meistens verbringt man die ersten 15 Minuten damit, die Tests zu machen. Je nach Marke des Kits muss der Lehrer vor Beginn der Testung die Pufferlösung in die Röhrchen geben und an die Schüler*innen austeilen. Zusätzlich erhält jeder einen Teststreifen und ein Stäbchen für den Abstrich.
Hier kann man schon einen gravierenden Kritikpunkt feststellen, der sich bei Testungen im Schulgebäude kaum vermeiden lässt: Verlorengehen von wichtiger Unterrichtszeit. Dadurch, dass die Abstriche Zeit in Anspruch nehmen und während dem Unterricht vollzogen werden, wird diese Zeit nicht für wertvolle Lerninhalte genutzt.
Eine mögliche Verbesserungsoption könnte das Testen zuhause sein. Dies würde vorbeugen, dass wichtige Zeit für den Unterricht verloren geht, der bei dem diesjährigen hohen Stundenausfall definitiv Gold wert ist. Falls ein Test positiv ausfallen sollte, könnte sich der Betroffene auch direkt isolieren, ohne sich bereits im Schulhaus zu befinden und die Ansteckungswahrscheinlichkeit damit zu erhöhen.
Man kann allerdings sagen, dass Testungen an Schulen dazu beitragen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten dadurch nachvollziehbarer bleiben als ohne Schnelltests. Höherer Schutz kann ebenfalls gewährleistet werden. Natürlich gab es eine große Umstellung für alle Beteiligten, doch mittlerweile gehört es zum Alltag dazu, weshalb man versuchen sollte sich anzupassen. Denn gegen Vorschriften kann man wenig tun. Nichtsdestotrotz gibt es immer Verbesserungspotential und gerade bei einer neuartigen Pandemie wie dieser sollte man das Beste tun, um dieses Potential auszuschöpfen.
Kommentar: Johanna S.