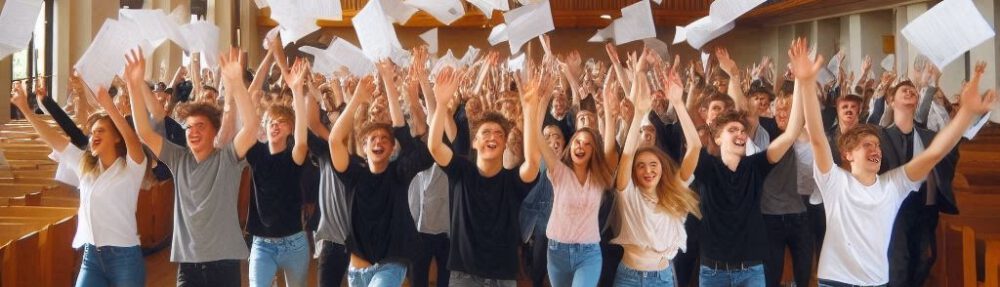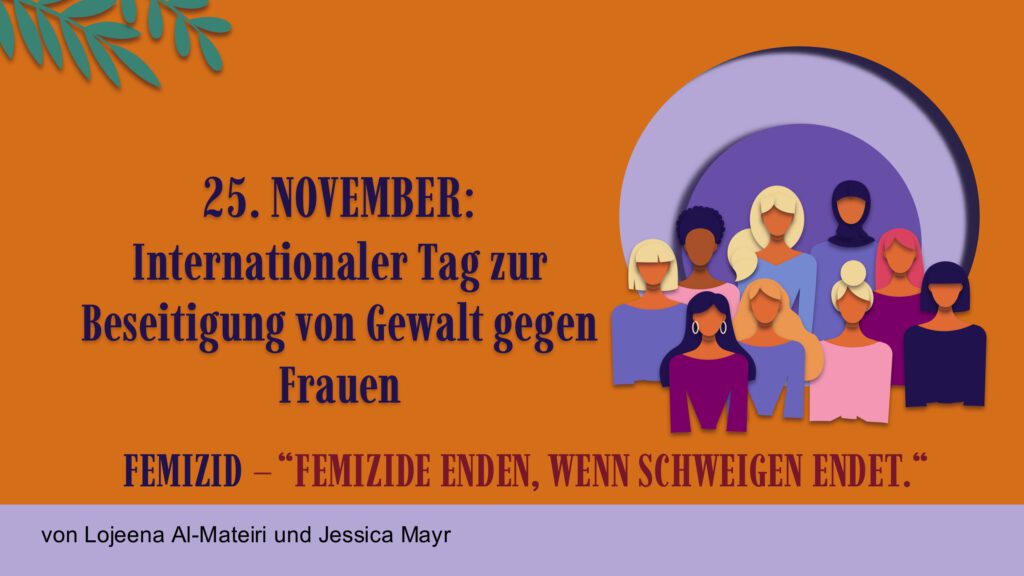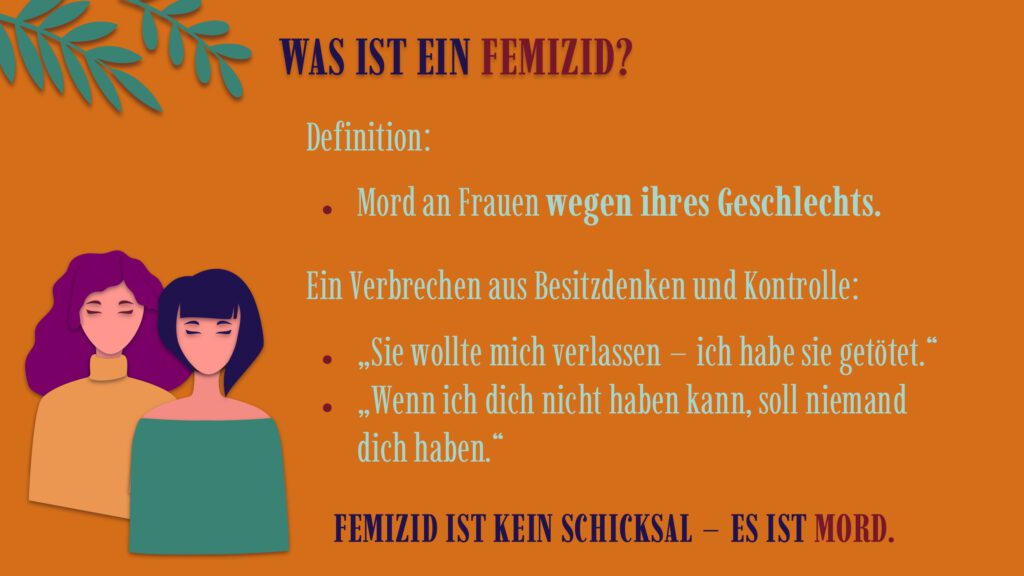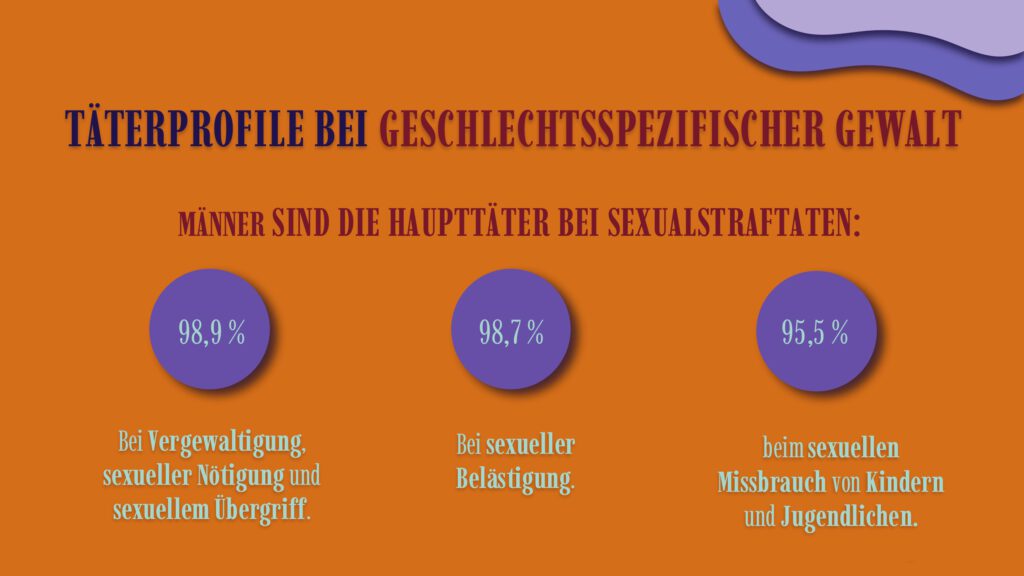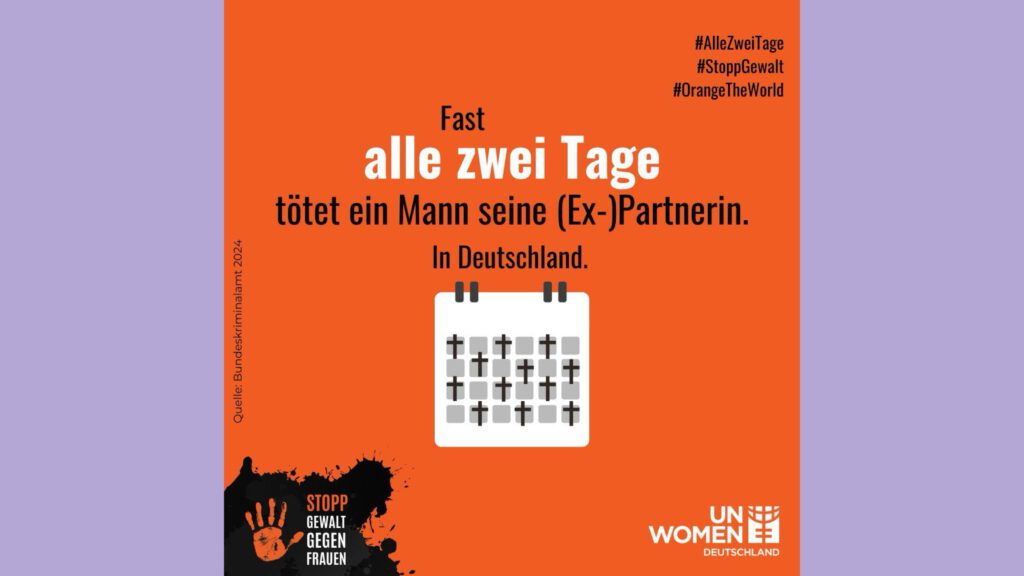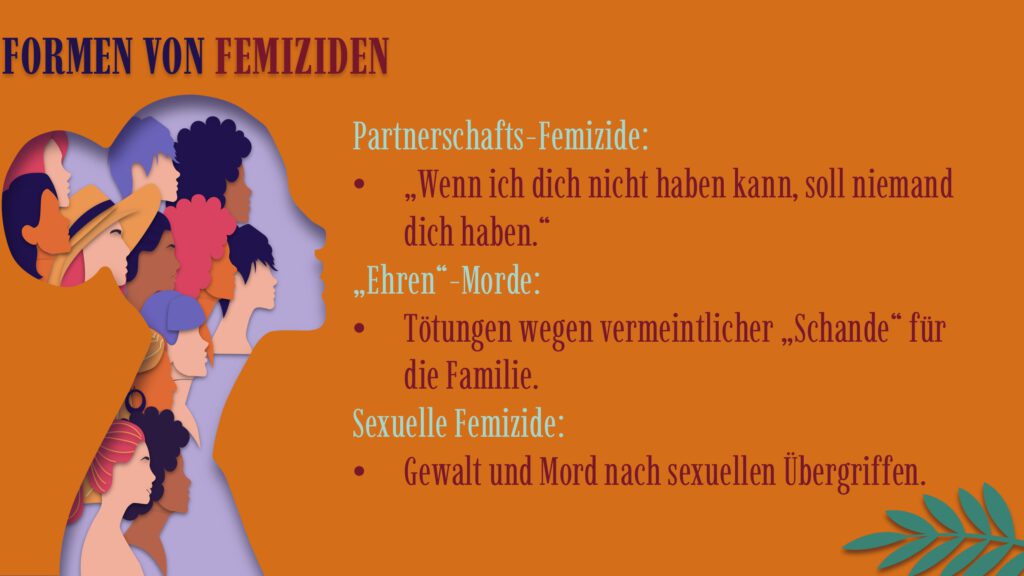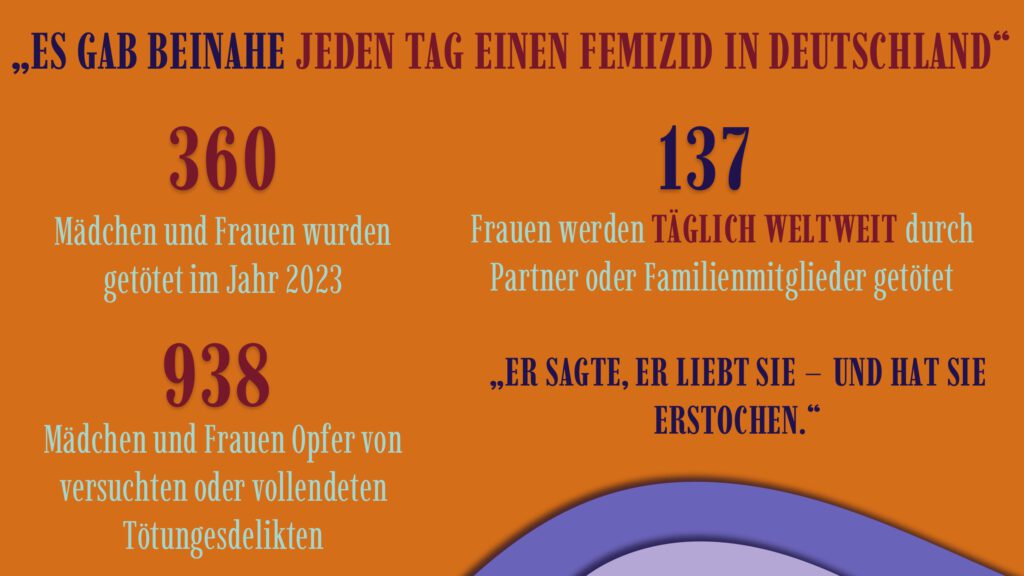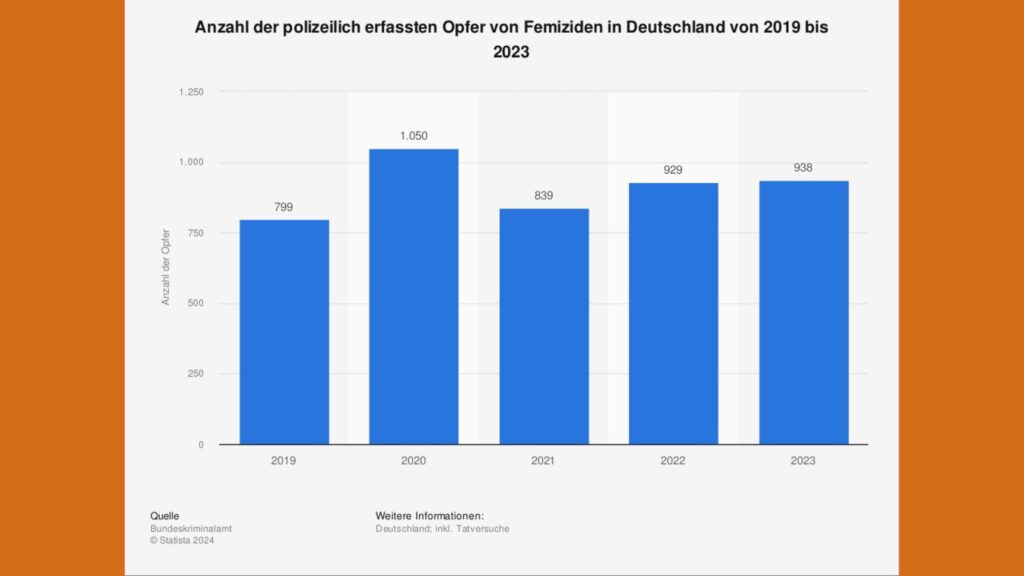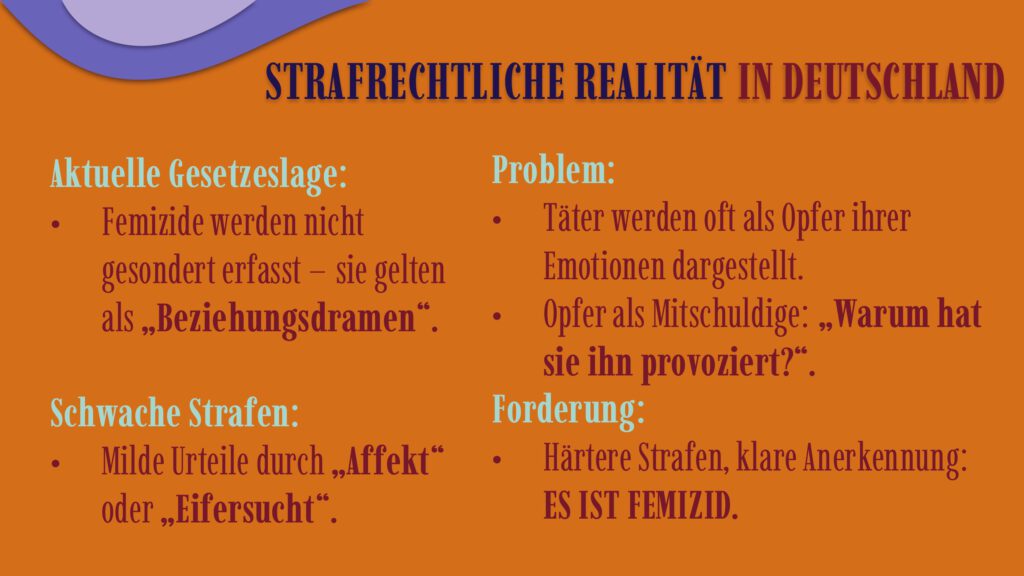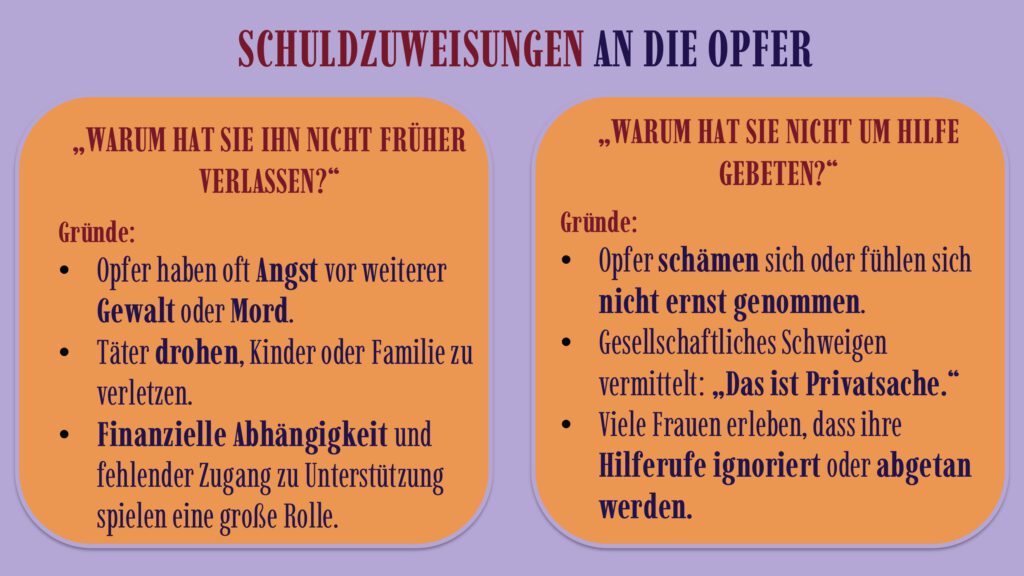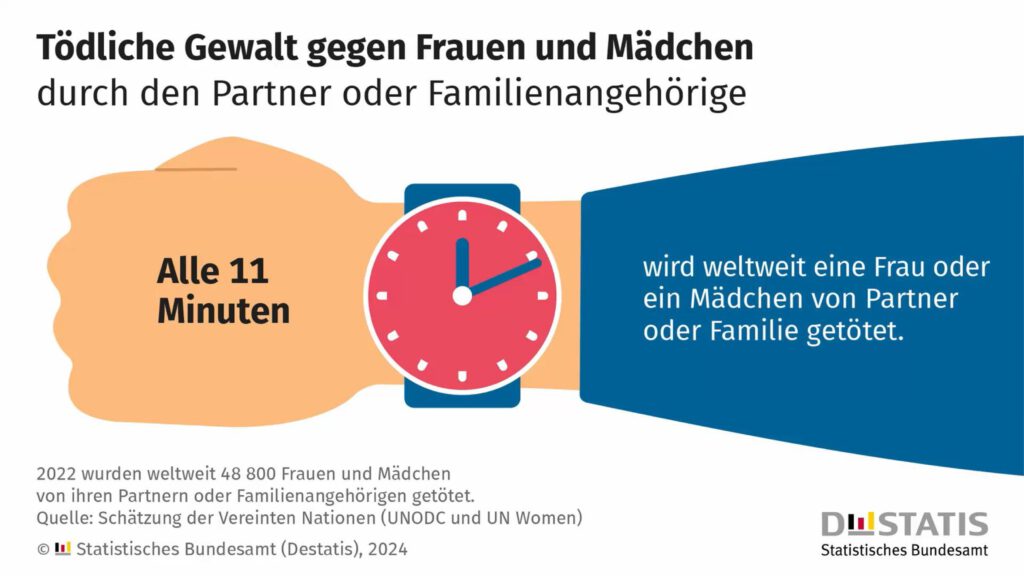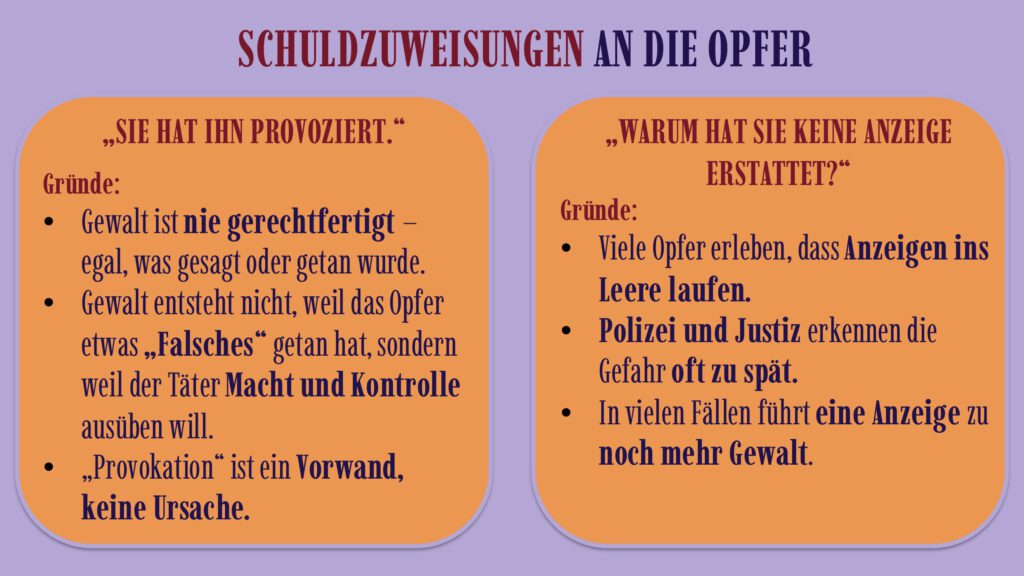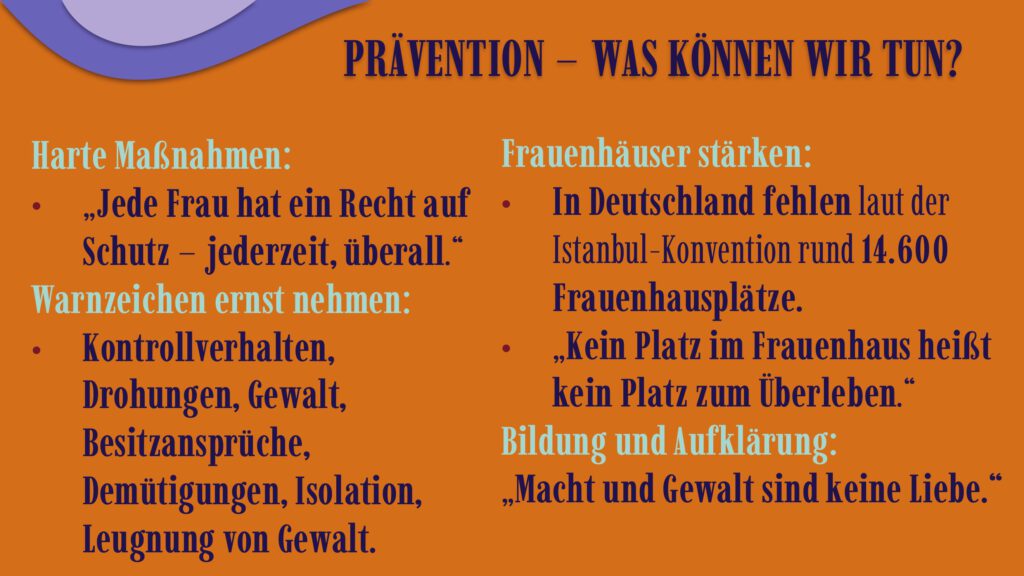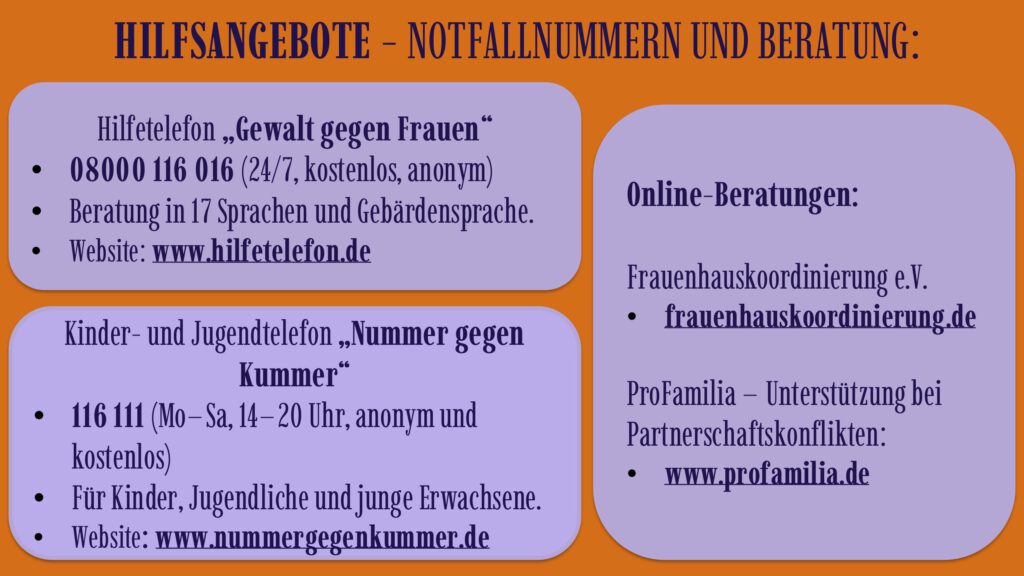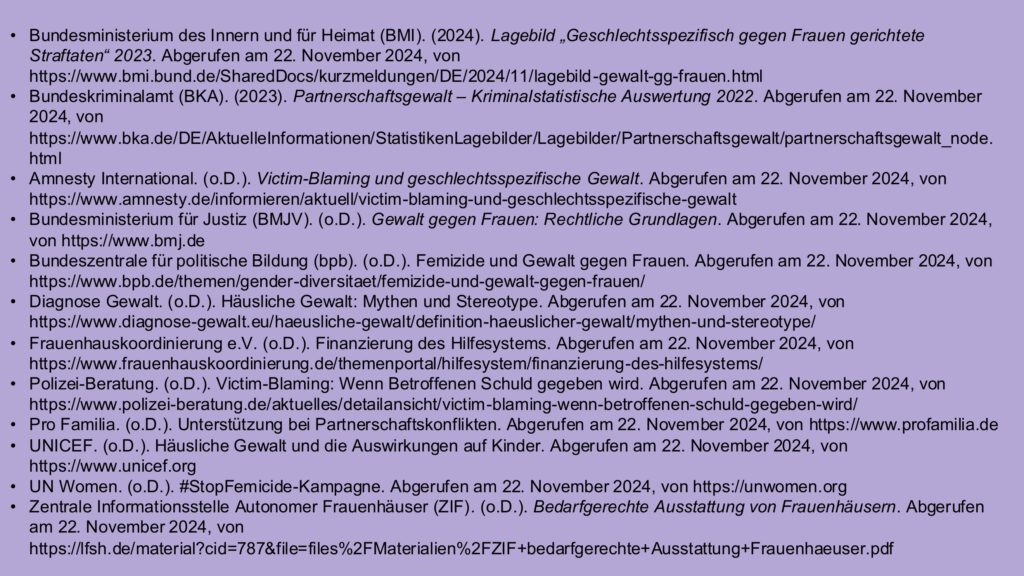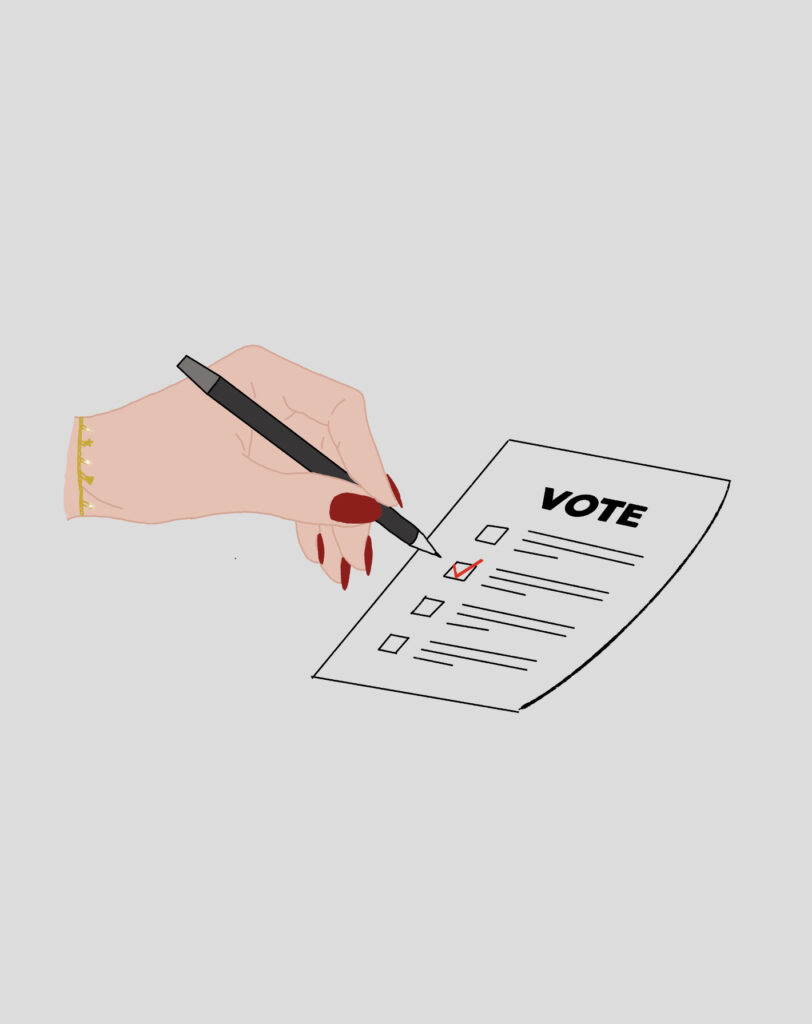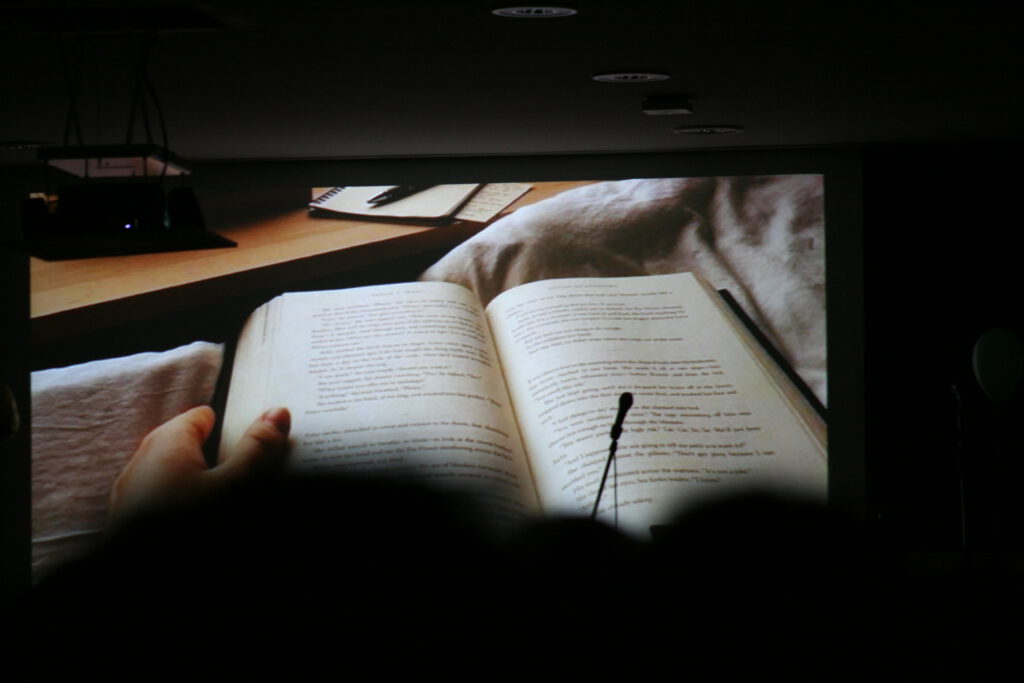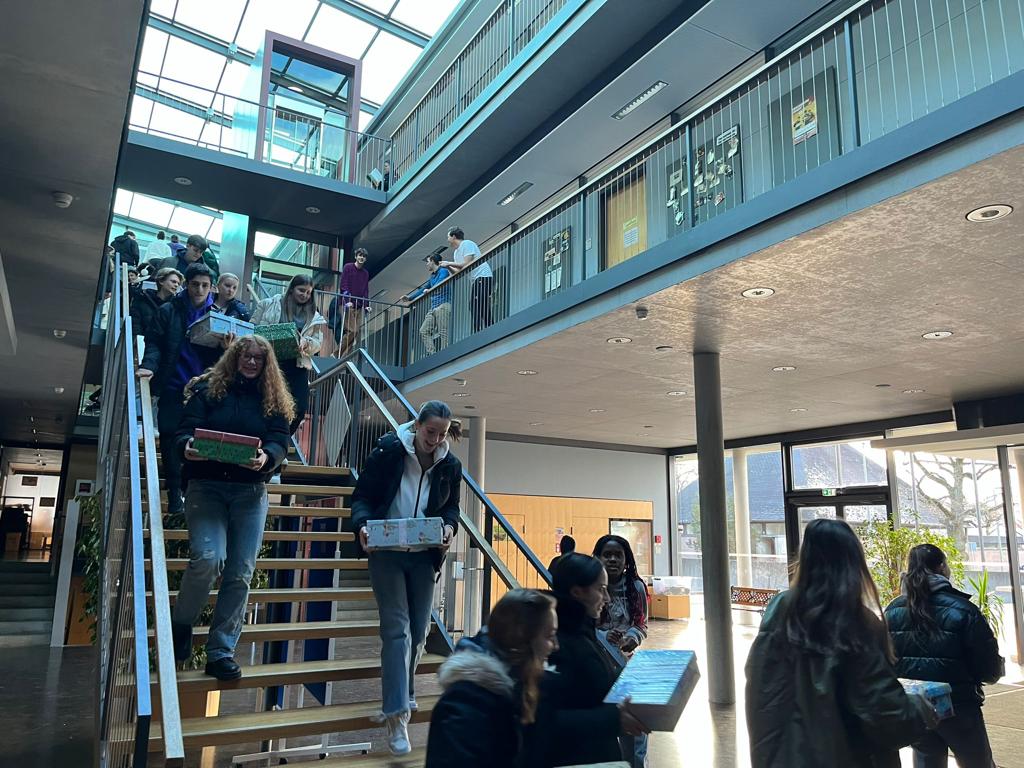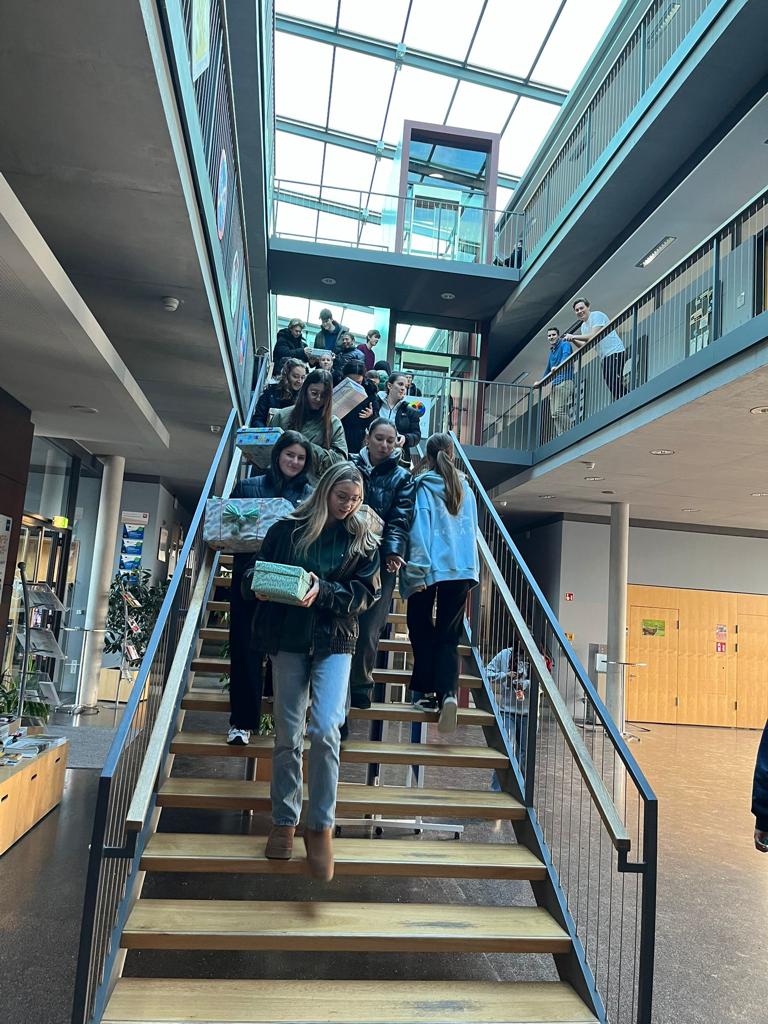Viele Christen stellen sich der Fastenzeit vor Ostern, dabei verzichten sie auf beispielsweise Fleisch oder Tierprodukte bei der Ernährungsweise, reduzieren ihren Medienkonsum oder distanzieren sich von weltlichen Aktivitäten und widmen sich der Anbetung und ihrer Zeit mit Gott. So machen es zumindest häufig Katholiken – die Orthodoxen gehen die Vorbereitung auf „Jesus vollbrachtes Werk“ ein Stück weit anders an. Doch wer sind die orthodoxen Christen eigentlich? Die Orthodoxie ist eine der Konfessionen des Christentums neben dem Katholizismus und dem Protestantismus. Die Glaubensrichtungen unterscheiden sich dennoch durch Wertschätzung von Tradition, Liturgie und mystische Glaubenserfahrung. Ein Unterschied zeigt sich dadurch, dass es keine zentrale Autorität wie den Papst gibt, sondern mehrere eigenständige Nationalkirchen, wie die russisch- und syrisch-orthodoxe Kirche.
Великий пост – „Das Große Fasten“ (russisch)
Victoria, die russisch-orthodox ist, berichtet von den eigenen Erfahrungen mit der Fastenzeit: „Wir beginnen unsere Fastenzeit am ‚Reinen Montag‘ etwa sieben Wochen vor Ostern. Verzichtet wird auf Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, auch oft auf Wein und Öl. Meine Familie passt sich individuell an die Fastenzeit an, da jeder unterschiedlich seinen Glauben ausführt und gesundheitlich ebenfalls verschiedene Grenzen bestehen. Meine Eltern und ich, wir nehmen uns zudem noch vor, auf Industriezucker zu verzichten, dennoch ist zum Beispiel Zartbitterschokolade erlaubt. Zudem entschieden wir uns dieses Jahr dazu, Fisch aus dem Verzicht auszuschließen, da die Schultage länger wurden und das Praktikum ins Schulleben eingeführt wurde. Außerdem fordern uns Training und der Arbeitsalltag. Unser Ziel ist es, sich innerlich zu reinigen und das Opfer Jesus mit unseren Körpern zu preisen, indem wir viele unnötige und schädliche Nahrungsmittel nicht konsumieren. Mein persönliches Ziel während des Fastens besteht darin, in Dankbarkeit für das vorhandene Essen zu leben und Gottes Gegenwart sowie sein Opfer für uns tiefer wahrzunehmen.“


ܣܘܪܝܝܐ – „Das Große Fasten“ (aramäisch)
Rawad, die syrisch-orthodox lebt, erzählt: „In unserer syrisch-orthodoxen Kirche unterscheidet sich das Große Fasten nicht wesentlich vom russisch-orthodoxen Brauch. Das Fasten beginnt ebenfalls an einem Montag und endet an einem Sonntag – dem Ostersonntag. Die Hauptfastenzeit dauert 50 Tage, und während dieser Zeit ist es nicht erlaubt, tierische Produkte zu sich zu nehmen (Milch, Käse, Eier, Fleisch usw.) – also eine vegane Ernährung. Einige Menschen verzichten jedoch nur auf Fleisch, konsumieren aber Milchprodukte – das entspricht einer vegetarischen Ernährung. Das ist jedoch kein offizielles Gesetz bei den Syrern, sondern eine persönliche Entscheidung, um das Fasten zu vereinfachen. Um die Fastenzeit zu erleichtern, ist es Gläubigen erlaubt, nur in der ersten und letzten Woche sowie mittwochs und freitags während der Fastenzeit zu fasten. Es ist nicht erlaubt, nur auf Dinge zu verzichten, die man ohnehin gerne aufgeben möchte – zum Beispiel darf jemand, der raucht, nicht nur auf das Rauchen verzichten. Während der Fastenzeit sollte der Gläubige, wenn möglich, sieben Mal am Tag beten.„
Rawad meint auch: „Schwangere Frauen, stillende Mütter, Kinder und kranke Menschen sind vom Fasten ausgenommen. Während der Fastenzeit sind Hochzeiten und Taufen nicht erlaubt. Ich persönlich faste die vollen fünfzig Tage, während meine Familie nur in der ersten und letzten Woche sowie mittwochs und freitags fastet. Das Fasten bedeutet mir sehr viel – es gibt mir ein Gefühl von innerem und körperlichem Frieden, und es hat mich gelehrt, für alles, was ich habe, dankbar zu sein“.
Die Fastenzeit ist – in egal welcher Konfession – so viel mehr als ein bewusster Verzicht auf Nahrungsmittel. Dabei zweigt man sich von der hektischen Alltagswelt ab und nimmt eine Pause ein, um sich wieder im Glauben zu finden und spirituell zu wachsen. Der Fokus des Ganzen darf niemals vergessen werden: Jesus ist für uns und unsere Sünden am Kreuz gestorben, für die Liebe, die Gott – unser Vater – für uns bis heute und für immer bedingungslos empfindet. Anschließend, auferstanden, hat er den Tod und die Sünde durch seinen eigenen Tod besiegt, damit wir die Möglichkeit haben, auch nach dem Tod, ein unendliches Leben mit Gott zu führen. Hier kommen alle Konfessionen und Kirchen zusammen, um dieses Fest gemeinsam zu feiern
Text/Fotos: Rawad O., Victoria H.