
Spitzenthema: Umwelt und Nachhaltigkeit

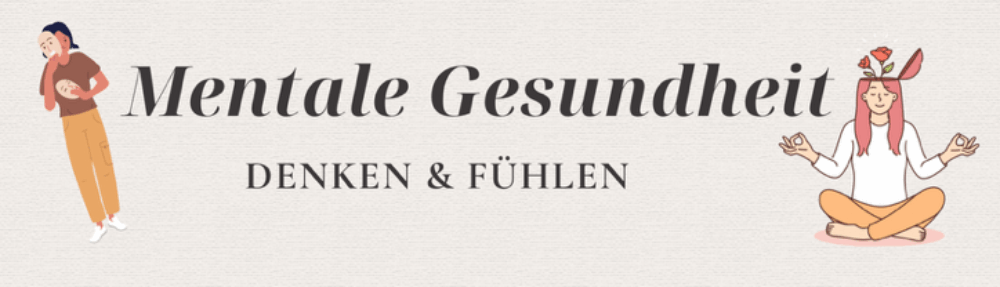

Kurze Zeit nach dem 20. August 2018, an dem sie sich mit einem Protestschild vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm platzierte, wurde Greta Thunberg zur Mediensensation. „Skolstrejk för klimatet“ – Schulstreik für das Klima – stand darauf. Als Repräsentantin der globalen Klimaschutzbewegung übte sie über das letzte Jahr hinweg auf so manchen Veranstaltungen Druck auf die Regierungen aus, initiierte was später zur allerseits bekannten Bewegung „Fridays for Future“ wurde und berührte ihre Zuhörer mit prägenden Botschaften wie „Ich will dass ihr handelt, als würde euer Haus in Flammen stehen, denn das tut es!“ oder „Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen“. Die junge Aktivistin ist in Rekordzeit zu einem Symbol des Klimaschutzes geworden, und das gerade einmal mit 16 Jahren. Der Friedensnobelpreis jedoch blieb der Schwedin verwehrt und viele Kritiker glauben, die Bewegung habe sich mittlerweile in eine überschwängliche Hysterie verwandelt, mit der man nichts weiter anfangen könne.
Für Greta gibt es keine Grauzone, was die Thematik Klimawandel angeht, und wenn man ihr eines lassen muss, dann dass sie es geschafft hat, diesen Gedanken laut werden zu lassen. Der Schulstreik für das Klima hat Millionen von Menschen weltweit, vor allem Schüler und Studenten aus etwa 100 Ländern, regelmäßig auf die Straßen getrieben, um miteinander für eine verbesserte Klimapolitik zu protestieren. Zusätzlich „adressierte“ Greta viele ihrer Reden und wandte sich auch persönlich an unzählige Staatsoberhäupter und Politiker, von denen sie, auch weiterhin, ein verantwortungsvolleres Verhalten gegenüber den nachkommenden Generationen fordert, die mit den Folgen des Klimawandels werden leben müssen.
Vor allem ihre Schulstreik-Aktionen jedoch sind nicht überall gerne gesehen – bei den Schulen zum Beispiel, die oftmals die Meinung vertreten, dass einer Umweltschutzdemonstration beizuwohnen, keine Rechtfertigung dafür sei, regelmäßig den Unterricht zu versäumen oder dass es genug Schüler gäbe, die gar kein wirkliches Interesse hätten, die Aktion stattdessen als Gelegenheit zum Schwänzen sähen.Greta selbst bleibt von Vorwürfen ebenfalls nicht verschont, besonders – wer hätte es gedacht – im Internet. Dort stößt sie momentan zunehmend auf Ablehnung und Hass. Die Missgunst ihr gegenüber hört jedoch nicht dabei auf, dass man sie als unsympathisch empfindet oder der Meinung ist, sie würde gänzlich übertreiben und sich verhalten, als müssten wir „alle morgen sterben“, dabei auch noch der Elterngeneration brutale Vorwürfe machen, obwohl sie in ihrem Alter doch noch kaum Lebenserfahrung habe, wie sich oft geäußert wird. Hier lässt sich einfügen, dass wahrscheinlich gerade ihre Emotionalität gegenüber der Thematik ihr zu Bekanntheit verholfen hat, denn von sachlich gehaltenen, nüchtern betrachteten Dingen fühlt sich der Einzelne meist weniger angesprochen. Hinzu kommen die Meinungen derer, die sagen, dass Greta langsam aufhören sollte, weil sie unabhängig davon, wie oft sie auftritt, nie in der Lage sein wird, den Klimawandel aufzuhalten und dass der Druck von außen ihr irgendwann schaden könnte. Diese Kritik ist natürlich berechtigt, denn klar: dass sie mit ihren Worten keinen magischen Schalter umlegen kann, ist uns allen mehr als bewusst.
Hat man als erwachsener Mensch jedoch nichts Sinnvolleres zu tun als einer 16-jährigen Autistin, welche sich für ihren Planeten einsetzt, vulgäre Ausdrücke hinterher zu schmeißen oder gar Morddrohungen zu machen, wie es in letzter Zeit vermehrt passiert ist, so sollte man vielleicht einmal darüber nachdenken, ob man nicht selbst ein kleines bisschen hysterisch sein könnte. Jüngst hat der US-Präsident – neidisch auf Thunbergs Auszeichnung als „Time Person of the Year“ – die schwedische Rebellin auf Twitter aufgerufen, doch „mal zu chillen“.
Wie lange Greta weiterhin in der Öffentlichkeit stehen wird, bleibt vorerst unklar, jedoch ist bekannt, dass sie die Schule nun wieder aktiv besucht. Bis jetzt hält ihr Erfolg zumindest schon länger an als der ihrer berühmten Vorgängerin Severn Cullis-Suzuki, die 1992 als als „das Mädchen, dass die Welt zum Schweigen brachte“ bekannt wurde.
Text von Sandra Hanke, erstmalig erschienen am 14. Dezember 2019
Von klein auf wurde uns beigebracht, unsere Sachen mit anderen Menschen zu teilen. Seien es einfach nur bunte Holzstifte oder auch die süßen Bonbons. „Ach, sei doch nicht so und gib ihr auch eins“ oder „Bald bekommst du es zurück, keine Sorge!“ sind ganz normale Sätze, die jeder von uns schon mal als ein kleines Kind gehört hat. An sich stimmt das auch, die Sachen waren nach einiger Zeit wieder an ihrem Platz und alles war gut. Oft war es sogar so, dass man mit den Spielzeugen der anderen Kinder spielen konnte und von ihnen Süßigkeiten bekommen hat. So wurde uns damals durch Spiel, Spaß und Freude das „harmlose Teilen“ beigebracht.
Später im Schulleben, dann das „verantwortungsvolle Leihen“. „Kann ich mir kurz deinen Radiergummi ausleihen? Ich hab meinen vergessen.“. Wem wurde diese Frage noch nie gestellt? Seine Schulsachen mit den Klassenkameraden zu teilen, gehört zum Alltag aller Schulkinder und in der Regel halten sich auch alle dran und geben das geliehene Schulmaterial wieder zurück, wenn sie es nicht mehr brauchen – immerhin gehören diese Sachen ja nicht ihnen.

Aber das beste Beispiel für das verantwortungsvolle Ausleihen in der Schulzeit sind die allbekannten Schulbücher, denn wer seines nicht mehr findet, muss plötzlich zahlen! Das gabs davor nicht. Teilen, leihen, austauschen. Alltagsbegriffe, denen die meisten mit positiven Gefühlen begegnen, denn wie heißt es im Englischen so schön? „Sharing is Caring!“. Doch gilt dieser Slogan auch für unsere Umwelt?
Seit den 2010er-Jahren wird in viele EU-Staaten fleißig „geteilt und geliehen“. Laut den Statistiken der Europäischen Kommission sind die Top 3 der EU-Länder mit der größten Nutzung der allgemeinen Sharing-Angebote Frankreich, Irland und Deutschland, wobei die Deutschen vor allem Transportmittel und Werkezeuge untereinander teilen. Brauchst du ein größeres Auto beim Umziehen? Kein Problem, kriegst du. Ein spezieller Bohrer und ein wunderschönes Hochzeitskleid sind auch im Angebot. Die Vielfalt an Gütern, die im Internet heutzutage ausleihbar sind, hat keine Grenzen. Es gibt immer jemanden, der bereit ist, etwas Teures oder Ausgefallenes auszuleihen. Kaufen musst du es auf jeden Fall nicht. Willst du einmal im Leben auf das Oktoberfest gehen und brauchst ein Dirndl oder eine Lederhose, um das volle Erlebnis zu genießen? Diese Dinge sind furchtbar teuer, da erstarrt man schon bei dem Anblick des Preisschildes. Doch hab‘ keine Angst, die netten Menschlein im Internet geben dir unglaublich gerne das Kleid für viel weniger. Da freut sich auch dein Geldbeutel. Einfach sich das schöne Stück aussuchen, einen Deal abschließen und „Ding Dong“ schon ist dein ausgeliehenes Dirndl mit der Post da.
„Aber warte mal, was? Mit der Post? Geht’s noch? Das sind doch nur zusätzliche CO₂-Emissionen, denk an unsere Umwelt.“
Da mag sich der eine oder andere aufregen. Doch ist an dieser Aussage wirklich was dran? Unsere heutige Digital-Gesellschaft kauft gerne und oft Kleidung online ein, ohne wirklich zu wissen, ob sie sie haben wollen. Die Kleidungsstücke kommen an, sie werden anprobiert, passen nicht oder gefallen einem doch nicht und „Schwupps“ werden sie in einen Karton gesteckt und zurückgeschickt. Also wird genauso viel CO₂ ausgestoßen wie beim Ausleihen eines Kleidungsstücks online.
Und was ist sonst noch so schön am Teilen? Richtig, die Güter und Gegenstände werden nicht unnötig in Boxen oder Schränken gefangen gehalten, sondern „ins Freie gelassen“ und von anderen Menschen mit Freude genutzt. Unsere Werkzeuge, Kleidung und Fahrzeuge wurden gemacht, um benutzt zu werden, nicht um den ganzen Tag in der Ecke zu liegen, beziehungsweise in Schränken zu schlummern. Da ist es besser, wenn die selten genutzten Güter mehr Menschen zur Verfügung gestellt werden.
Die meisten Gegenstände gehen mit der Zeit auch schneller kaputt, wenn sie unbenutzt bleiben. Denkt an die Batterien und Akkus! Am Ende ist man gezwungen, sich diesen Gegenstand noch nachzukaufen, weil er zu lange nicht verwendet wurde. Da hätte der Besitzer ihn doch verleihen können – auf jeden Fall hätte er auch was davon gehabt, genauso wie die Umwelt. Beim Ausleihen können nämlich Ressourcen gespart werden, aufgrund dessen, dass mehr Produkte im Umlauf sind und dementsprechend weniger hergestellt werden muss.
So schön die Idee der „Sharing Economy“ auch klingen mag, dürfen wir nicht vergessen, dass wir dadurch dazu neigen, mehr zu konsumieren oder uns durch das eingesparte oder verdiente Geld mehr Sachen erlauben. „Wieso sollte ich mit dem Fahrrad fahren, wenn ich mir doch ein Auto ausleihen kann?“ oder „Ich habe in den letzten Monaten so viel Geld gespart, die Flugreise nach Spanien ist so gut wie umsonst!“ sind gute Beispiele für die Denkweisen Einiger, die an der „Sharing Economy“ teilnehmen. Dieser zusätzlicher Konsum bedeutet eine zusätzliche Belastung für die Umwelt. Hoppla, wohl doch nicht so nachhaltig wie gedacht.
Also kann die „Sharing Economy“ positiv zum Umweltschutz beitragen? Diese Frage zu beantworten ist nicht leicht, da hier sehr viele Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Aber eins ist sicher: mit einer guten und nachhaltigen Einstellung unserer Gesellschaft, kann das Konzept der „Sharing Economy“ unsere Umwelt um einiges entlasten. Zwar ist in den meisten Fällen Geld der Ansporn für das Teilen und nicht etwa das Bedürfnis mit anderen zu teilen, doch es gibt auch reflektierte Menschen, die ihr Eigentum teilen, um unserer Umwelt zu helfen. Es sollte mehr von ihnen geben, denn seien wir mal ehrlich – Teilen ist eine schöne Angelegenheit!
Kommentar von Kamila S. vom 23. November 2019
Es ist ein seit Jahren diskutiertes Thema mit stark polarisierten Meinungen und kontroversen, teils sehr emotionalen Debatten zwischen Gegnern und Befürwortern des Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Eine Regierungskommission für Klimaschutz entfachte diese Debatte mit ihrem neuesten Vorschlag nun ein weiteres Mal – wenn auch bereits bekannt ist, dass es sich bei der Regierung zumindest vorläufig nicht durchsetzen konnte.

Es ist ein seit Jahren diskutiertes Thema mit stark polarisierten Meinungen und kontroversen, teils sehr emotionalen Debatten zwischen Gegnern und Befürwortern des Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Eine Regierungskommission für Klimaschutz entfachte diese Debatte mit ihrem neuesten Vorschlag nun ein weiteres Mal – wenn auch bereits bekannt ist, dass es sich bei der Regierung zumindest vorläufig nicht durchsetzen konnte.
Für diese Frage müssen wir uns einmal die unterschiedlichen Gruppen ansehen, die hier diskutieren. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Autoindustrie und deren enthusiastische Kunden. Wenn man den teuren Wagen wirklich nirgends noch zum vollen Potential ausfahren kann, wozu kauft man ihn dann? Da tut’s dann auch ein mittelklassiger. Heißt also: den Eigentümer kostet es das „Freiheitsgefühl“ und den „Spaßeffekt“, den Autohändler seinen Profit – und die Automobilindustrie ist der mit Abstand bedeutendste Industriezweig Deutschlands, von dem weit über 800000 Arbeitsplätze abhängen, welche durch reduzierte Käufe hochwertiger Modelle potenziell gefährdet wären. Entsprechend wehrt sich die in ihrer Macht nicht zu unterschätzende Auto-Lobby mit allen Mitteln gegen eine Einführung des Tempolimits 130.
Diesen Leuten gegenüber stehen in der Problematik hauptsächlich Umweltschutzaktivisten, die ein Tempolimit als praktikablen Schritt in Richtung CO2 Reduktion sehen und Privatpersonen so wie ihre Vertreter, die die Ansicht vertreten, dass es irrational und unverantwortlich sei, kein Tempolimit einzuführen, nur um das Ego der Auto-Liebhaber nicht zu kränken. Damit liegen sie auch weitgehend richtig, denn Unfallprävention sollte von höchster Bedeutung sein und für unsere Umwelt würden jährlich über 3 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Zusätzlich würde der Spritverbrauch sofortig verringert. Auch sollen Staus durch einen geringeren Geschwindigkeitsunterschied auf den Fahrstreifen vermieden werden und das anhaltende Wettrüsten der globalen Automobilindustrie soll beendet werden.
Ob aber ein Tempolimit wirklich mehr Probleme lösen würde, als es kreiert, sei dann doch einmal dahingestellt. Dass sich diese Entscheidung gar nicht so einfach treffen lässt, zeigt sich auch in den gleichmäßigen Meinungsverteilungen, denn hier steht es quasi 50/50. Somit wird der Regierung zusätzlich erschwert, eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Als Mittelmaß wird von manchen in Betracht gezogen, 150 als Limit festzulegen. Damit sollen die Folgen für Autoindustrie und Nutzer eingedämmt und gleichzeitig das Rasen nicht länger unterstützt werden. Ein Anfang wäre das sicherlich, doch stellt sich noch immer die Frage, ob sich ein Fahrer, der sich einen Wagen im fünfstelligen Bereich leisten kann, wirklich darum scheren wird, dass er gelegentlich einen Strafbetrag zahlen muss, um dann doch nochmals ein bisschen schneller zu fahren. Immerhin schreckt dass erfahrungsgemäß bis jetzt nur wenige Raser ab.
Kommentar von Sandra Hanke vom 18. November 2019
Greta Thunberg, erhöhte Umweltbelastung und der G20-Gipfel – jetzt beginnt der Umweltschutz so richtig!? Nein! Auf dem ersten Blick vielleicht schon, aber beim zweiten habe ich mich auf jeden Fall beim Klimagipfel verirrt. Die Politik nimmt sich zwar auf dem Papier ständig vor, die Umwelt zu schützen, indem man zum Beispiel Treibhausgase stark senkt. Doch immer wieder nur leere Luft! Anstatt ihre Thesen in die Tat umzusetzen, lassen Politiker sich häufig von Lobbyisten umgarnen.

Für die immer mehr kriselnde deutsche Autoindustrie werden immer wieder verzweifelnd und hängeringend Ausnahmen gemacht, damit die Speerspitze der deutschen Konjunktur weiterhin die großen Gewinne einfährt. Doch das Problem liegt hier ganz wo anders! Statt Ziele terminlich nach hinten zu verschieben oder umweltpolitisch gesehen sinnlos in die falsche Richtung zu korrigieren, hätte die deutsche Automobilindustrie früher aus ihrem Winterschlaf erwachen sollen. Stattdessen haben sie es sich in ihrer eigenen Märchenwelt bequem gemacht und alle Tatsachen schön geredet oder sogar geschwiegen. Dies fängt mit dem Dieselskandal von Volkswagen an und hört bei der hauseigenen Edelmarke Audi auf.
Auch in Sachen Internet fühlt sich unser Land eher wie ein Entwicklungsland an. Auf andere Standbeine zu setzen – darauf scheint Schwarz, Rot, Gold noch nicht gekommen zu sein. Deshalb gilt für Deutschland: Wacht auf – sonst verpassen wir endgültig den Sprung auf neue Technologien und werden wirklich abgehängt. Vielleicht muss dafür sogar einfach mal Personal im Bundestag ausgetauscht werden – und dies sollte meiner Meinung nach nicht nur einzelne Parteien treffen. Denn bisher gilt: Die Große Koalition – ein schlafender Riese!
Kommentar von Fabian Wölfle vom 18. November 2019
Inzwischen sollte die wichtige Thematik, dass wir unseren Konsum nachhaltiger gestalten müssen, bei jedem angekommen sein, da es so nicht weitergehen kann. Aber was heißt das überhaupt?

Klimastreiks, Klimapaket, Klimagipfel. Wichtige politische Ereignisse. Und viel mehr als das. Im Vordergrund steht immer, dass wir unser Leben verändern müssen. Wieso das? Ein Blick auf den ökologischen Fußabdruck, der den alltäglichen Verbrauch von Ressourcen eines Menschen in globalen Hektar angibt, zeigt, dass wir Deutschen einen ökologischen Fußabdruck von 5,3 gha haben. Allerdings stehen eigentlich jedem nur 1,73 gha zu. Ich sehe schon die erhobenen Zeigefinger vor mir. „Aber die anderen sind doch viel schlimmer.“ Stimmt sogar. Teilweise. Um Beispiele zu nennen: Luxemburg mit 15,8 gha oder Katar mit 10,8 gha sind viel schlimmer. Aber dadurch wird unser Wert auch nicht besser, denn unser Konsum geht auf die Kosten derjenigen, die extrem kleine Fußabdrücke haben wie zum Beispiel Eritrea mit 0,4 gha.
Diese Zahlen sollten zumindest jeden von uns ein bisschen schockieren. Und so stellt sich die Frage nach den Folgen. Was passiert, wenn wir nichts ändern? Bisher klappt’s doch auch so. Naja. Wir schädigen unsere Welt, unser Klima. Wir produzieren viel zu viel Plastikmüll, der unsere Meere verschmutzt und die tierische Unterwasserwelt stark belastet. Wir blasen Tonnen an Treibhausgasen wie CO2 in die Luft, indem wir jede noch so kleine Strecke mit dem Auto zurücklegen und gerne in den Urlaub fliegen. Strom oder Wasser sparen ist für viele von uns auch ein Fremdwort. Außerdem konsumieren wir Unmengen an Fleisch und shoppen, was das Zeug hält, wodurch ebenfalls wieder viele Treibhausgase entstehen und zudem große Wassermengen verbraucht werden. Was macht das mit unserer Welt? Es wird immer wärmer. Die Gletscher schmelzen. Der Meeresspiegel steigt an. Tierarten sterben aus. Naturkatastrophen wie Hurrikans und Waldbrände sind auch keine Seltenheit mehr. Die Ressourcen werden knapper. Möglicherweise gelingt es unserer Generation noch, die Augen davor zu verschließen, indem wir die Weltnachrichten gekonnt ignorieren. Denn wir leben nicht in den betroffenen Regionen wie in Afrika, wo es zu großen Dürreperioden kommt. Aber spätestens unsere Kinder oder Enkelkinder werden uns danken, dass wir uns so sehr bemüht haben.
Diese Zahlen sollten zumindest jeden von uns ein bisschen schockieren. Und so stellt sich die Frage nach den Folgen. Was passiert, wenn wir nichts ändern? Bisher klappt’s doch auch so. Naja. Wir schädigen unsere Welt, unser Klima. Wir produzieren viel zu viel Plastikmüll, der unsere Meere verschmutzt und die tierische Unterwasserwelt stark belastet. Wir blasen Tonnen an Treibhausgasen wie CO2 in die Luft, indem wir jede noch so kleine Strecke mit dem Auto zurücklegen und gerne in den Urlaub fliegen. Strom oder Wasser sparen ist für viele von uns auch ein Fremdwort. Außerdem konsumieren wir Unmengen an Fleisch und shoppen, was das Zeug hält, wodurch ebenfalls wieder viele Treibhausgase entstehen und zudem große Wassermengen verbraucht werden. Was macht das mit unserer Welt? Es wird immer wärmer. Die Gletscher schmelzen. Der Meeresspiegel steigt an. Tierarten sterben aus. Naturkatastrophen wie Hurrikans und Waldbrände sind auch keine Seltenheit mehr. Die Ressourcen werden knapper. Möglicherweise gelingt es unserer Generation noch, die Augen davor zu verschließen, indem wir die Weltnachrichten gekonnt ignorieren. Denn wir leben nicht in den betroffenen Regionen wie in Afrika, wo es zu großen Dürreperioden kommt. Aber spätestens unsere Kinder oder Enkelkinder werden uns danken, dass wir uns so sehr bemüht haben.
Außerdem: Nachhaltigkeit ist für Schüler meist zu teuer. Warum? Weil die höhere Qualität und Umweltverträglichkeit ihren Preis hat. Die Produktion von Fair Trade Produkten ist durch die Material- und Herstellungskosten sowie gerechten Löhne mit höheren Kosten verbunden, für die der Endverbraucher sowohl bei Kleidung und Nahrungsmitteln, als auch bei anderen nachhaltig hergestellten Produkten aufkommen muss. Und viele von uns wären sicher dazu bereit, für diese Fairness mehr zu bezahlen. Das ist nur leider für uns Schüler häufig nicht möglich. Auch wenn ich gerne Kleidung kaufen würde, die nicht zu unmenschlichen Bedingungen hergestellt wird, fehlt mir als Schüler einfach das Geld. Unser Einkommen beschränkt sich auf das Taschengeld und hart erarbeitete Einkünfte durch Nebenjobs. Davon wollen wir unsere gesamte Freizeit finanzieren und nebenbei auch noch einen Teil sparen. Im Umgang mit unserem Geld stehen – wenn wir mal ehrlich sind – wir im Vordergrund und nicht irgendwelche armen, ausgebeuteten Kinder in Bangladesch oder Indien. Ganz nach dem Prinzip: Aus den Augen, aus dem Sinn. Also stehen wir am Ende doch wieder vor dem Problem, dass wir zu egoistisch sind, unseren komfortablen Lebensstil für die anderen zu ändern.

Außerdem: Nachhaltigkeit ist für Schüler meist zu teuer. Warum? Weil die höhere Qualität und Umweltverträglichkeit ihren Preis hat. Die Produktion von Fair Trade Produkten ist durch die Material- und Herstellungskosten sowie gerechten Löhne mit höheren Kosten verbunden, für die der Endverbraucher sowohl bei Kleidung und Nahrungsmitteln, als auch bei anderen nachhaltig hergestellten Produkten aufkommen muss. Und viele von uns wären sicher dazu bereit, für diese Fairness mehr zu bezahlen. Das ist nur leider für uns Schüler häufig nicht möglich. Auch wenn ich gerne Kleidung kaufen würde, die nicht zu unmenschlichen Bedingungen hergestellt wird, fehlt mir als Schüler einfach das Geld. Unser Einkommen beschränkt sich auf das Taschengeld und hart erarbeitete Einkünfte durch Nebenjobs. Davon wollen wir unsere gesamte Freizeit finanzieren und nebenbei auch noch einen Teil sparen. Im Umgang mit unserem Geld stehen – wenn wir mal ehrlich sind – wir im Vordergrund und nicht irgendwelche armen, ausgebeuteten Kinder in Bangladesch oder Indien. Ganz nach dem Prinzip: Aus den Augen, aus dem Sinn. Also stehen wir am Ende doch wieder vor dem Problem, dass wir zu egoistisch sind, unseren komfortablen Lebensstil für die anderen zu ändern.
Diese Liste an kleinen Veränderungen könnte man noch ewig fortsetzen. Was ich eigentlich sagen möchte: Auch wenn wir gerne mal die Scheuklappen aufsetzen, um keinen Blick nach links oder rechts riskieren zu müssen, kann es so nicht weitergehen. Sonst bräuchten wir nämlich wirklich einen „Ersatzplaneten“. Wir alle müssen etwas ändern. Zumindest jeder ein bisschen. Keiner von uns ist perfekt, aber wir können uns doch zumindest etwas mehr Mühe geben. Uns zuliebe. Unseren Mitmenschen zuliebe. Unserem Zuhause zuliebe.
Kommentar von Leoni, F12GC vom 30. Oktober 2019