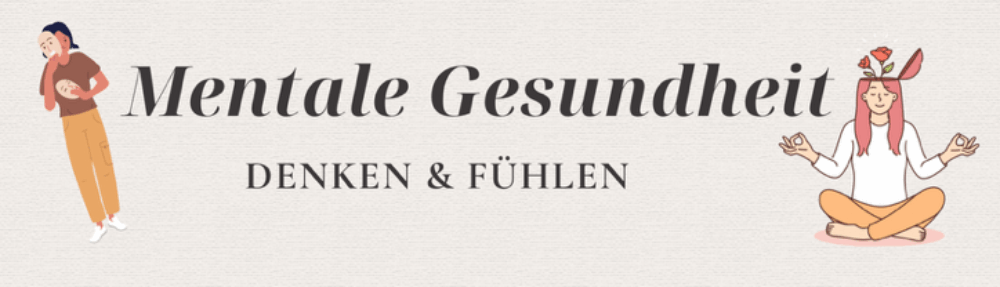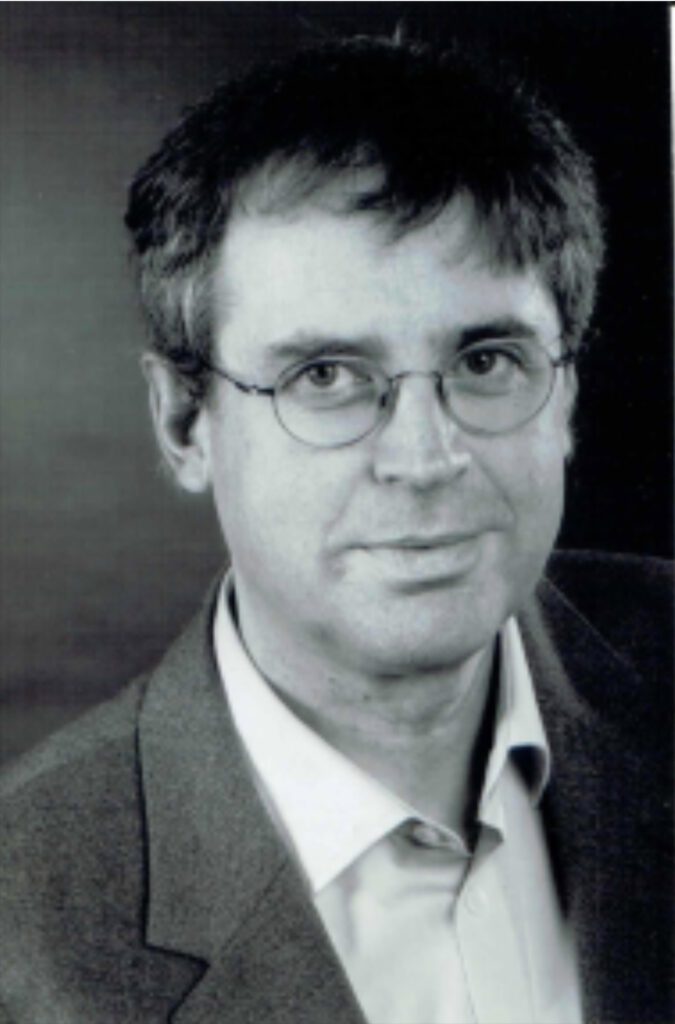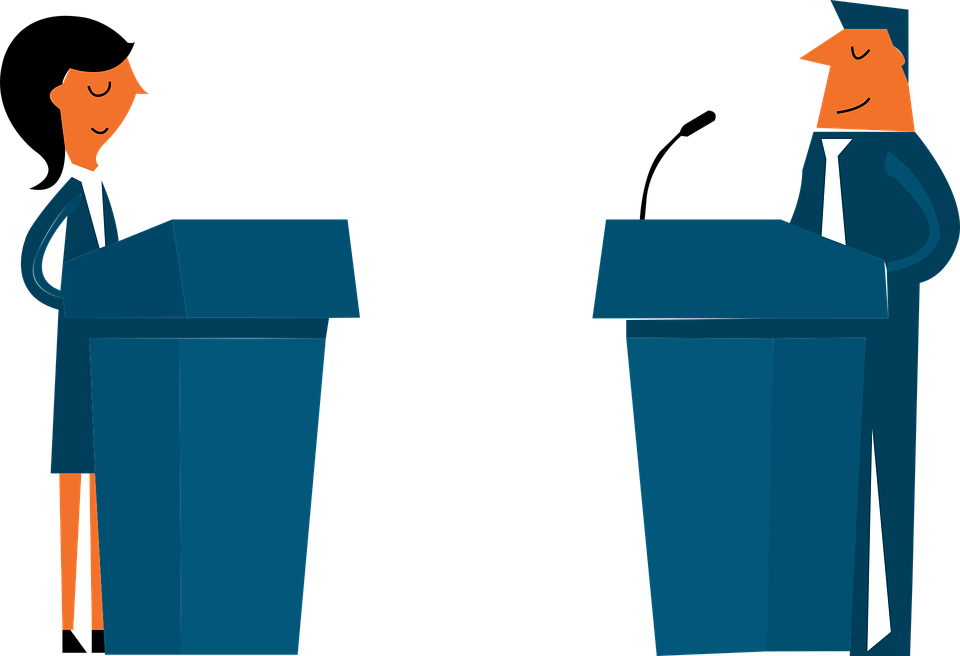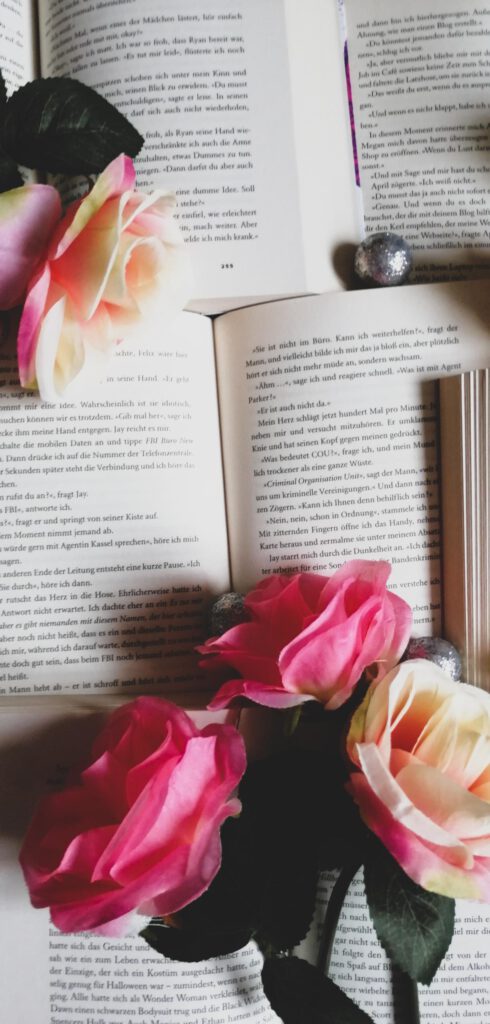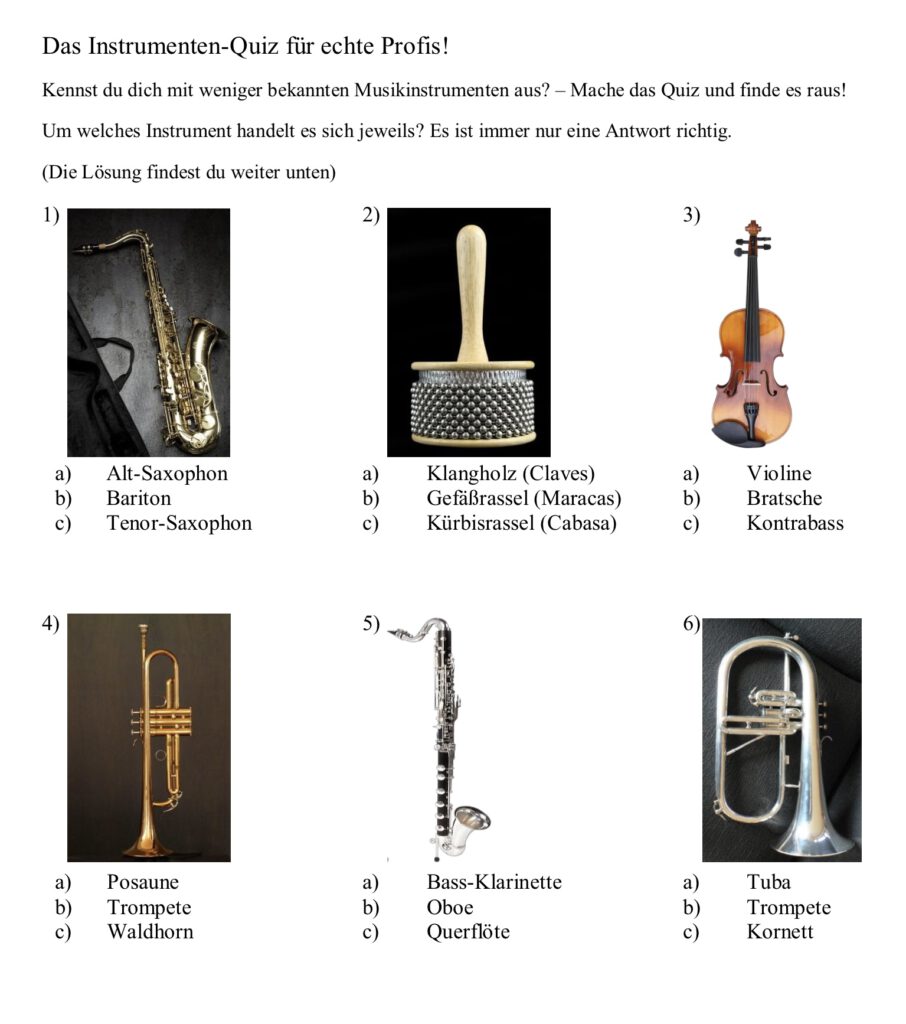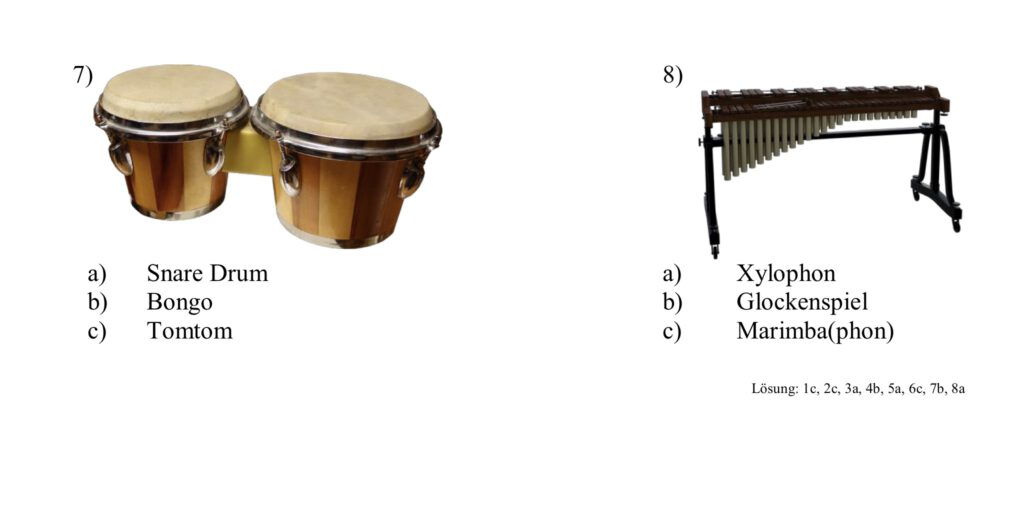Am 26. März 2021 ging ein regelrechter Aufschrei durch die katholische Kirche. Der Grund: Rapper Lil Nas X (bürgerlicher Name: Montero Lamar Hill) veröffentlichte das Musikvideo zu seinem lang erwarteten Song „Montero (Call Me By Your Name)“. Darin verwendet er Darstellungen aus dem christlichen Glauben – auf seine ganz eigene Art.
Das Video
Das Video beginnt mit dem Rapper unter einem Baum im Garten Eden. Die Szene ist recht friedlich: Mit seiner Gitarre singt er die erste Strophe des Liedes. Dann kommt die Schlange ins Spiel – ebenfalls gespielt von Lil Nas X selbst. In der Bridge und dem Refrain des Liedes verführt diese den Rapper zur Sünde, ähnlich wie Eva zum Essen des Apfels verleitet wurde. Hier finden Kritiker bereits die erste Kontroverse: Der offen schwule Sänger wird nämlich nicht zum Essen eines Apfels verleitet, sondern küsst die „Schlange“.

Im folgenden Vers wird Lil Nas X dann „vor Gericht“ geführt – die Engel, alle ebenfalls von ihm dargestellt, verurteilen ihn für seine Sünden. Im nächsten Refrain beginnt dann der Kern des Videos: Anstatt in den Himmel aufzusteigen, greift Nas nach einer Stange und gleitet an ihr hinab in die Hölle. Für diese Szene lernte der Rapper extra Pole-Dancing und zeigt dies nun auch. Auf diesem „Ritt“ in die Hölle präsentiert er sich, wie es oft sein Stil ist, sehr androgyn, also sowohl maskulin als auch feminin. In der Hölle angekommen, spaziert er direkt zum Thron, auf welchem Satan sitzt und tanzt auf sehr suggestive Art und Weise für ihn. Im Outro bricht Nas schließlich dem Teufel das Genick und nimmt die Krone der Hölle an sich. Das Video endet mit einer Nahaufnahme von ihm als Luzifer.
Die Bedeutung
Im Juni 2019 outete Lil Nas X sich öffentlich als schwul. Seitdem geht er sehr offen mit seiner Sexualität um, was ihm viele Fans, aber auch viele Kritiker einbringt. Doch der Musiker lässt sich nicht unterkriegen: In „Call Me By Your Name“ verarbeitet er den Hass, den die katholische Kirche in Teilen ihm und anderen Mitgliedern der LGBTQ+ Community entgegenbringt. Mit einem sehr sexualisierten Text in Verbindung mit den Bildern im Video will Nas vor allem eins: eine Kontroverse schaffen. Nach dem Motto „Wenn ich in die Hölle gehen soll, dann auf meine Weise“ zeigt er auf seine ganz eigene Art der Kirche den metaphorischen Mittelfinger. In einem Interview mit dem Time Magazine erzählt der Sänger, dass er selbst in einem sehr religiösem Haushalt aufwuchs und dies für ihn mit Angst vor seiner eigenen Sexualität verbunden war. „Call Me By Your Name“ soll nach eigener Aussage sowohl ein deutliches Zeichen gegen religiösen Missbrauch, als auch ein Signal für junge Menschen sein, die selbst in einer ähnlichen Situation sind. „Ich möchte dass Kinder, die mit diesen Gefühlen aufwachsen, wissen dass sie ein Teil der LGBTQ+ Community sind, das Gefühl haben okay zu sein, und dass sie sich nicht selbst hassen müssen.“
Die Kritik
Während das Lied zwar sehr viel positives Feedback erhielt, war auch die Kritik sehr harsch. Vor allem konservative und religiöse Menschen fühlten sich von dem Song und dem Musikvideo angegriffen. „Lil Nas X ist ein ganz neues Level von dämonisch“, schreibt eine Facebook-Userin. Die Sorge vieler dieser Leute scheint zu sein, dass ihre Kinder „schwul werden“, wenn sie das Musikvideo sehen. Die Intoleranz gegenüber queeren Menschen, also Mitgliedern der LGBTQ+ Community, die vor allem in Kreisen der katholischen Kirche immer wieder gesehen werden kann, bringt dem Sänger Tausende von Hasskommentaren ein. Doch da diese Reaktionen vorauszusehen waren, weiß Nas diesen Hass für sich zu nutzen und verwandelt die teils heftigen Kommentare in Witze. Mit dieser Reaktion wird er schnell zum Vorbild für viele queere Menschen – vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sehen in Lil Nas X ein Vorbild.
Genau das führt zu weiterem Zündstoff in den Reihen der Kritikern. Die Angst davor, dass das eigene Kind Teil der LGBTQ+ Community sein könnte, führt bei vielen konservativ-christlichen Eltern zu heftigen Gegenreaktionen. Sogar als Teufel selbst wurde der Rapper schon mehr als einmal bezeichnet. Nichtsdestotrotz wird er wohl weiterhin als eine Art Held für junge Menschen, die sich in ihrer Identität gefangen fühlen, betrachtet werden.
Homophobie in der Kirche
Wie bereit erwähnt, rührt der Hass vor allem von konservativ-religiösen Gemeinschaften her. Ein Grund dafür ist ohne Frage die andauernde Homophobie in der katholischen Kirche. Homosexuelle Paare dürfen weder kirchlich heiraten, noch gesegnet werden, wie der Vatikan unlängst verlauten ließ. Demnach entsprechen gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht dem göttlichem Willen und können deshalb nicht gesegnet werden.
Diese Aussage zog einen regelrechten Ansturm an Empörung nach sich – zurecht. Denn der Glaube, Homosexualität werde von Gott abgelehnt, wird oft mit einer Bibelstelle gerechtfertigt. „Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft; das wäre ein Gräuel“ (Levitikus 18, 22) – die Aussage scheint hier eindeutig zu sein. Jedoch wurde bereits mehrfach belegt, dass es sich um eine möglicherweise absichtliche Fehlübersetzung der Bibel handelt. Übersetzt man die Stelle richtig, so wird daraus „Du darfst nicht mit einem Jungen schlafen, wie man mit einer Frau schläft; das wäre ein Gräuel.“ Die Textstelle bezieht sich also nicht auf gleichgeschlechtliche Beziehungen, sondern auf Pädophilie.
Dennoch ist die Homophobie weiterhin ein großes Thema in der Kirche. Der Glaube, es handele sich bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen um „unnatürlich“, wird auch von konservativen Eltern weitergetragen. Immer noch wird vielen Kindern und Jugendlichen weißgemacht, dass ihre Sexualität und/oder ihr Geschlecht nicht richtig ist, etwas das man verstecken oder heilen muss. Dies führt dazu, dass das Suizidrisiko von Lesben und Schwulen zwischen 12 und 25 Jahren vier- bis siebenmal höher ist, als bei heterosexuellen Jugendlichen (Quelle: Coming Out Day e.V.). Zum Glück wird die Kritik an diesem Verhalten heutzutage immer lauter. Dank Vorbildern wie Lil Nas X fühlen sich junge queere Menschen etwas weniger alleine.
Fazit
Was viele als respektlos gegenüber der Kirche oder Religion aufgefasst haben, war im Endeffekt nicht mehr als eine persönliche Verarbeitung von religiösem Trauma und ein Zeichen gegen Homophobie. Rollenbilder wie Lil Nas X sind extrem wichtig für junge Menschen, die Teil der LGBTQ+ Community sind und sich in ihrer Identität unwohl fühlen. Dass konservativ-christliche Gemeinschaften sich angegriffen fühlen zeigt, dass die Nachricht des Musikvideos und Liedes sehr klar rüberkommt und effektiv ist.
Eins sollten Eltern, die sich über „Call Me By Your Name“ aufregen, wissen: Schwul. lesbisch, transgender etc. wird man nicht durch ein Musikvideo, aber es kann einem helfen, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Außerdem muss man keine Angst vor einem queeren Kind haben – es ist schließlich keine Krankheit, sondern einfach nur eine Variation in der Sexualität oder dem Geschlecht, die für ein bisschen mehr Farbe und Pluralismus in der Welt sorgt.
Kommentar: Gina H.