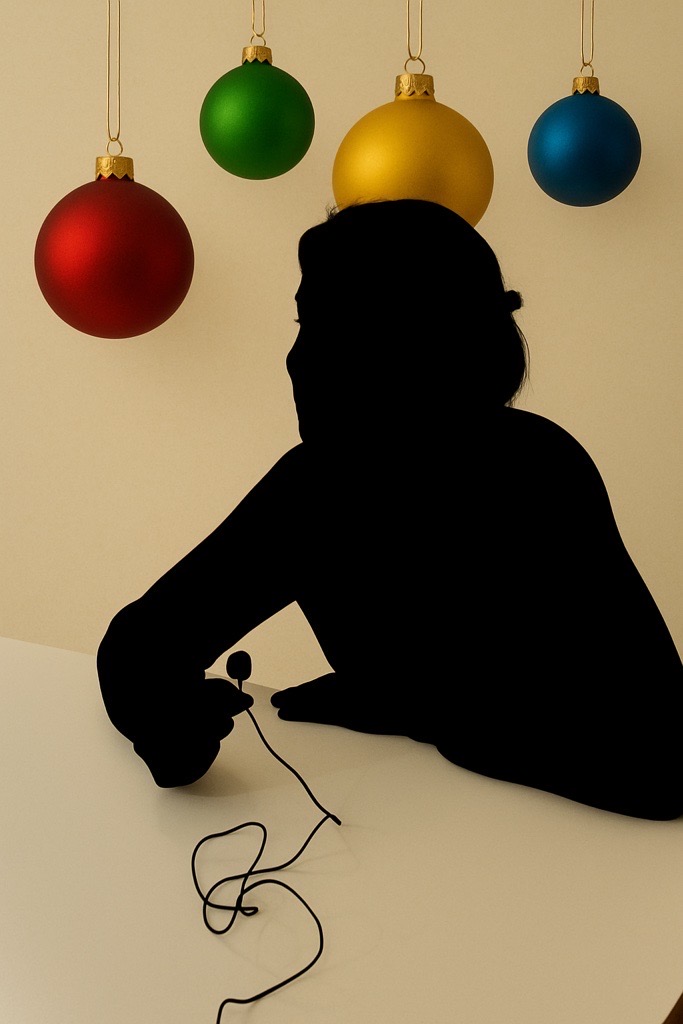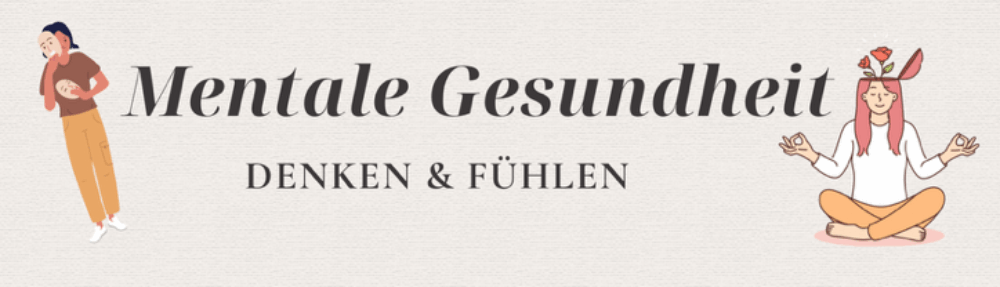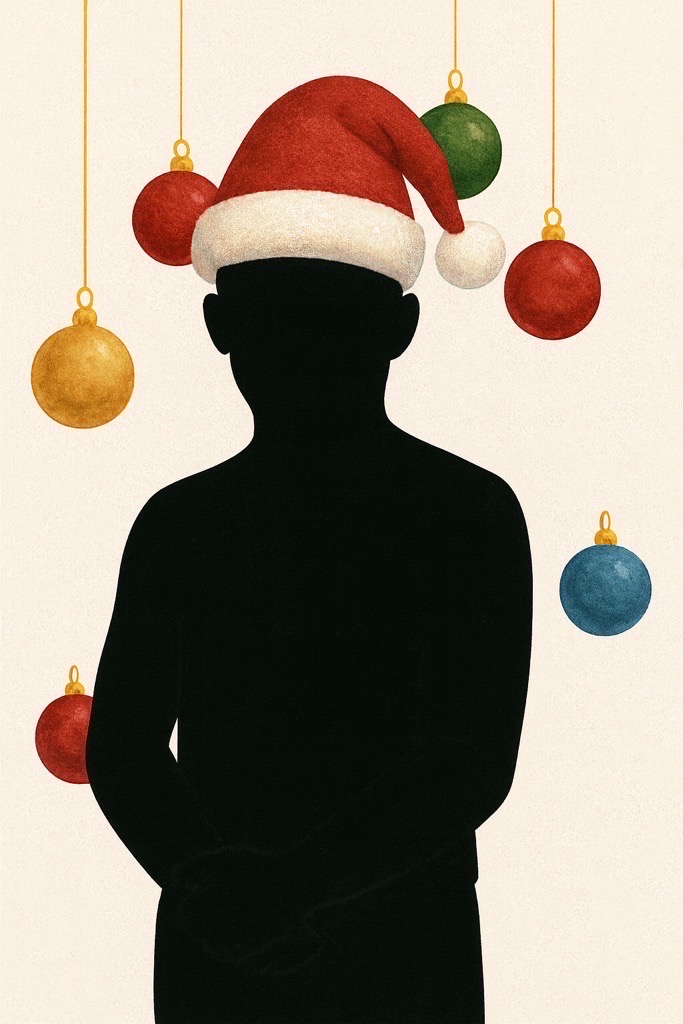Hey Leute,
die Adventszeit ist da! Überall Lichter, Plätzchen – aber mal ehrlich, auch ganz schön viel Stress, oder? Hausaufgaben, Klausuren, der ganze Trubel…
Genau deshalb haben sich ein paar echt coole Köpfe etwas Wunderbares ausgedacht, um mal kurz auf die Bremse zu treten: Sie haben den „Raum der Stille“ ins Leben gerufen!
Was ist das?
Der „Raum der Stille“ ist euer neuer persönlicher Fluchtpunkt. Die Idee dahinter ist super simpel: Mitten im oft stressigen Schultag bieten wir euch einen Ort, an dem ihr bewusst Innehalten könnt. Nur für ein paar Minuten.
Es ist ein offenes Angebot. Egal, ob du einfach nur deine Ruhe brauchst oder dich aktiv entspannen möchtest – du bist herzlich willkommen!
Was erwartet dich im Raum der Stille?
Hier geht es darum, den Kopf freizukriegen:
– Meditative Musik zum Abschalten
– Materialien zum Mandala-Malen.
– Anti-Stress-Basteln: Je nach Termin gibt es kleine, beruhigende Bastelangebote.
Wann geht’s los?
Hol deinen Kalender raus und kreuz das Datum an!
Der letzte Termin, um dem Vorweihnachtsstress zu entfliehen, ist am:
Mittwoch, 17. Dezember 2025 in E100
Wir sehen uns dort – entspannt und stressfrei!
Text und Angebot: Catharina Hubl