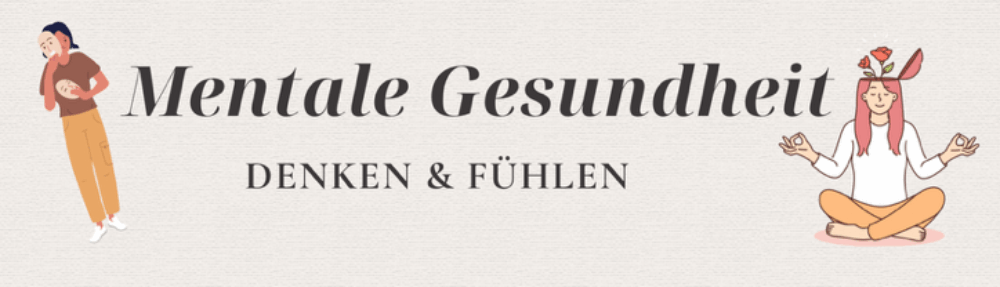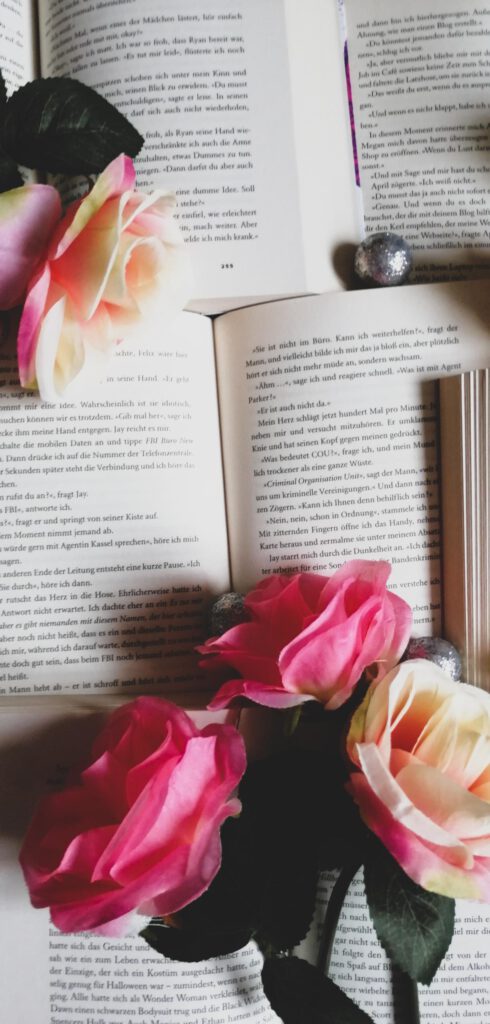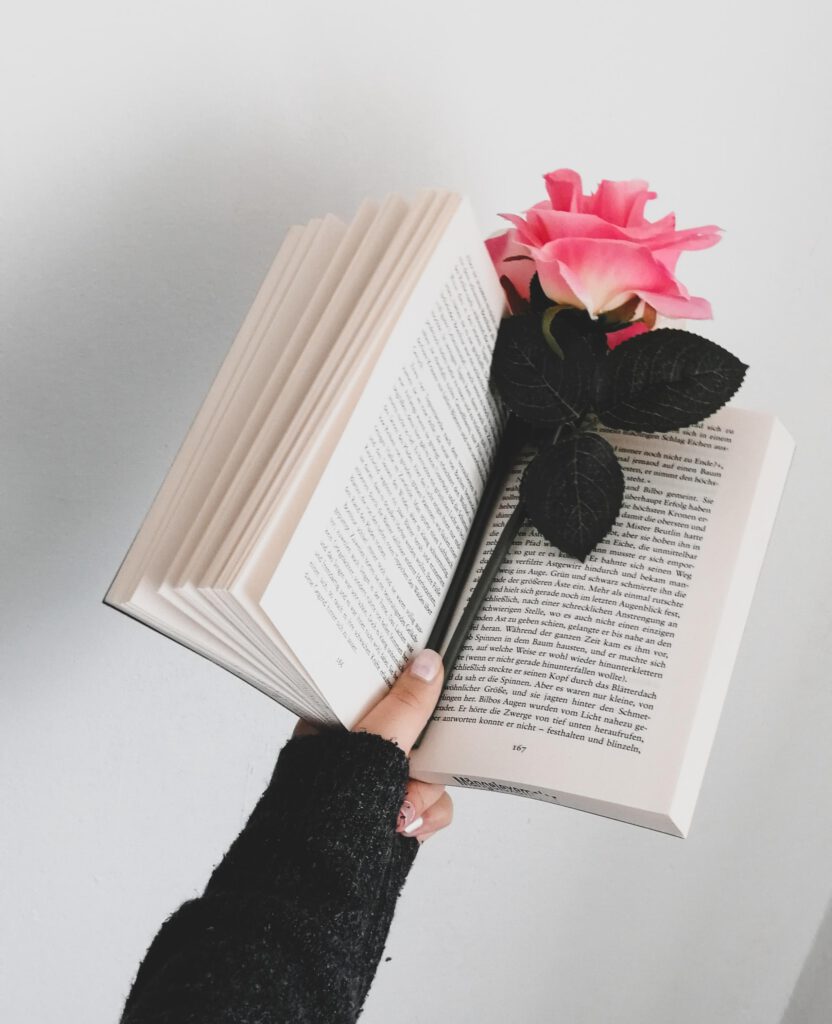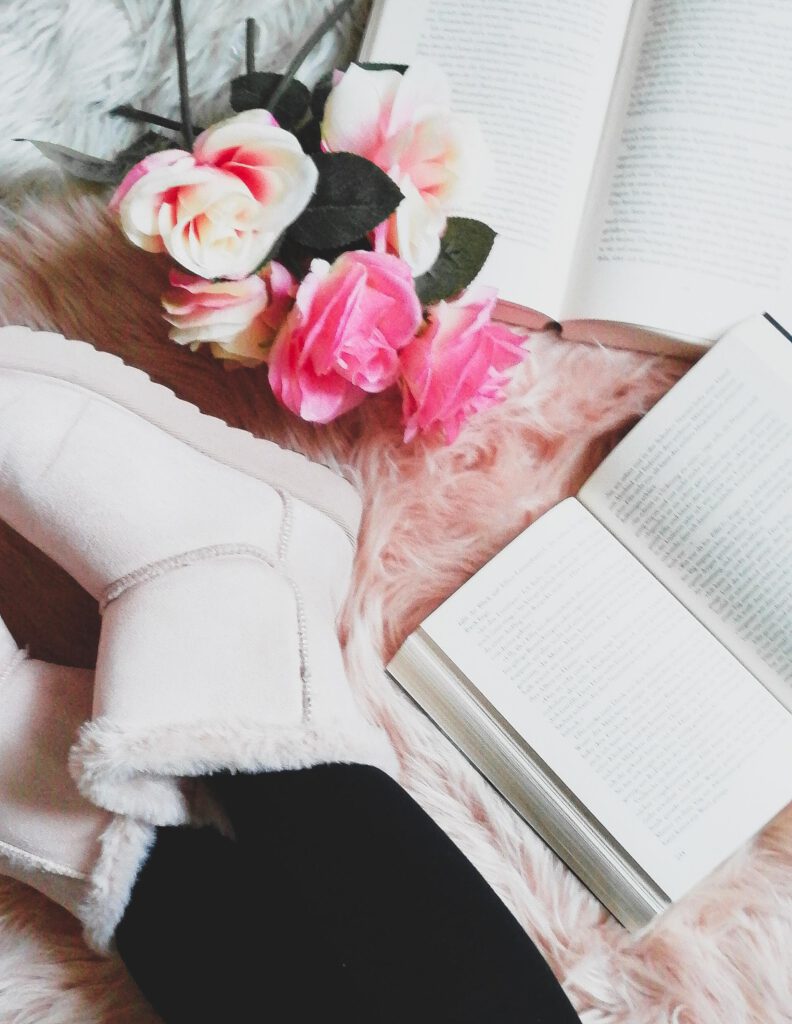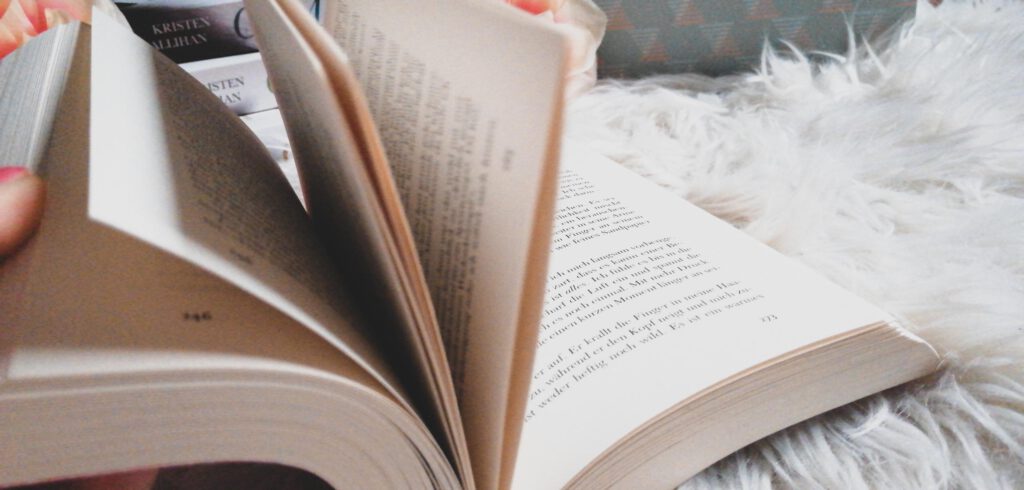„After Passion“, „The Kissing Booth“, „Chasing Red“ – die ersten beiden Buchtitel sind nicht nur als Filme erschienen und sind damit erfolgreich, sondern haben auch eine stabile Fangemeinde, die sich über den Erdball erstreckt. Dabei liegen dahinter ganz andere Wege als bei den Autoren, die mit ihren Ideen von den Notizheften ins Bücherregal gesprungen sind und zum Schluss auf die Leinwand; Stephen King, J. K. Rowling, Stephenie Meyer, J. R. R. Tolkien, Nicholas Sparks, Jeff Kinney, Mary Shelley, um hier ein paar traditionelle Beispiele zu nennen. Doch welche Rolle spielte hierbei die Online-Plattform „Wattpad“?
Wattpad als virtuelle Bibliothek
Wattpad wird als virtuelle Bibliothek bezeichnet, in der sowohl Leser als auch Schreiber ihre eigenen Ideen veröffentlichen können. Neben den Bewertungen, den Kommentaren und der Covergestaltung ähnelt es tatsächlich einer Buchveröffentlichung (von Verlagsvertrag, Marketing und Abrechnungen mal abgesehen). Die Kapitel sind kurz, die Prämissen teils ausgereift, teils bruchstückhaft und die Fantasie grenzenlos.
Was in den Köpfen von vielen abgeht, wird zu „Papier“ gebracht. Und das kann im schlimmsten Fall für den Autoren einen Shitstorm zur Folge haben, gerade, wenn es um noch subjektivere Dinge geht, wie etwa Fanfictions oder Gedichte. Ich selbst habe schon bemerkt, dass Wattpad deswegen oft von sogenannten Literaturexperten belächelt wird. Um das zu illustrieren: wiederholende Phrasen, „Low Budget“-Cover und Vierzehnjährige, die über fiktive Erfahrungen mit ihren Lieblings-Bands schreiben.

Die Meinungen spalten sich hierbei, genauso wie die Erfolgsgeschichten hinter den virtuellen Büchern für Aufruhr sorgen. Wenn Geschichten besonders viele Leser und Fans finden, werden sie unter Umständen zu internationalen Bestsellern, können als Printausgaben gelesen und schließlich auf der Kinoleinwand gesehen werden. Was aus Langeweile begann, wurde zum Millionenbusiness im „Online-Rampenlicht“. Das passierte etwa Anna Todd mit „After Passion“ und bescherte ihr seit 2014 eine loyale Fangemeinde.
Kreativität außerhalb von Klischees
Für Menschen, die ihre Kreativität außerhalb der Klischees spielen lassen wollen, bietet Wattpad eine gute Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen und Feedback zu bekommen – was sehr wichtig ist, wenn man das Schreiben wirklich ernst nimmt.
Um die Informationen in mein subjektives Fazit zu packen, wage ich zu behaupten, dass Wattpad genauso vielseitig ist, wie seine Nutzer. Niemand wird gezwungen, bestimmte Geschichten zu lesen, und wenn man es tut, ist Hate und Spott unangemessen und auch nicht lustig. Hinter den Geschichten kann monatelange Arbeit stecken – Wattpad dient als Sprungbrett für diejenigen, die ganz tief in die Welt der Literatur eintauchen möchten. Und wenn es schon kein Papier verschwendet, warum sollte diese Art von Ideenaustausch „gestoppt“ werden?
Text: Vanessa S.