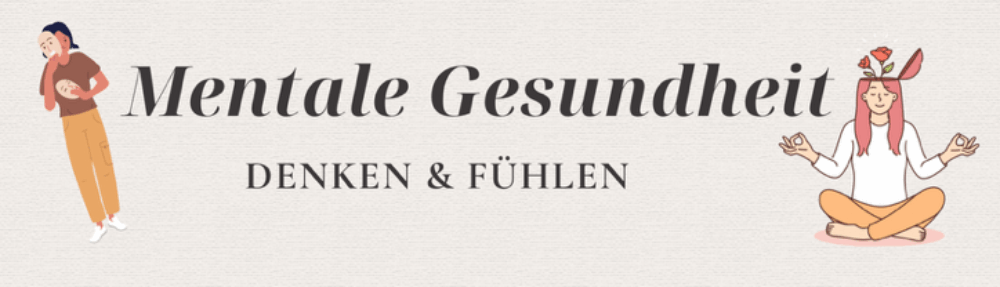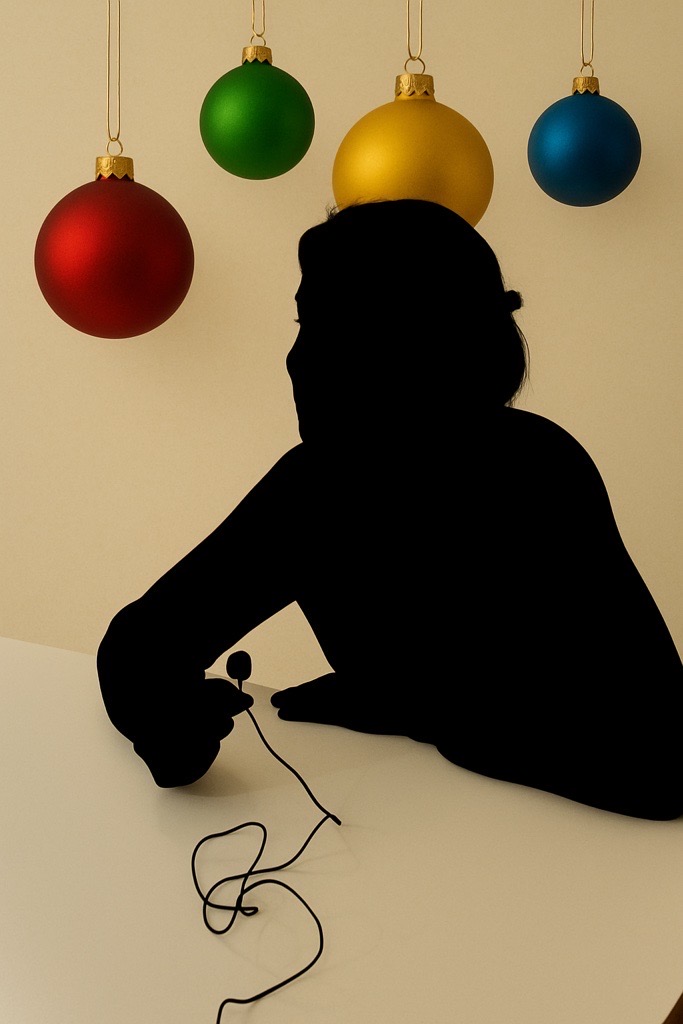Drei Tage kein Unterricht – dafür voll mit Proben, Kreativität, Filmen und Pizza. Unsere Theatergruppe, die dieses Jahr „Auerhaus“ auf die Bühne bringen wird, machte sich am Mittwoch auf den Weg nach Oberwittelsbach in das Jugendhaus „Emmaus“, um tatkräftig an dem Stück zu arbeiten. Ziel war es, Abläufe zu festigen und auch alles drum herum voranzubringen. Schon am ersten Tag wurde klar, dass die Theatertage kein Ausflug, sondern echte Arbeitszeit werden würden. Der Tagesplan war dicht, die Proben lang und die Erwartungen entsprechend hoch.
Im Mittelpunkt standen natürlich die Proben. Szenen wurden mehrfach gespielt, Kleinigkeiten verändert und die Übergänge verbessert. Dabei wurde nicht nur auf Texte geachtet, sondern auch auf Körpersprache, Timing und auf die Wirkung der Musik. Besonders hilfreich war die Möglichkeit, das Stück in einem Zug komplett durchspielen zu können. Gerade bei einem Stück wie „Auerhaus“, das manche mit „Gefühlschaos“ beschreiben würden, war es wichtig, die Figuren mit der benötigten Tiefe darzustellen. Diese Zeit half dabei, dass die Schauspieler sich besser in ihre Rollen einfühlen und die Gruppe als Team zusammenwachsen konnte. Besonders die Hauptdarsteller waren mit Proben von früh bis spät beschäftigt.
Der Rest der 26-köpfigen Gruppe war nicht untätig. Es wurde gefilmt und Interviews wurden geführt, um euch auf Instagram stets auf dem aktuellem Stand zu halten. Auch der Sneak Peak für die Open Mind Night am 12.2. stellte ein zentrales Thema dar (Kommt vorbei und seht selbst, ob dieser gelungen ist…). Die kreativen Köpfe der Gruppe machten sich Gedanken über die Gestaltung der Programmhefte, außerdem musste die Bühne dem Stück angepasst werden. Hier fielen auch ein paar T-Shirts den Farben zum Opfer. Deutlich wurde dabei, wie viel Arbeit hinter einer Theateraufführung steckt, die das Publikum später kaum wahrnimmt. Insgesamt wurde also niemandem langweilig, und wenn doch wurden helfende Hände immer bei Herrn Badde in der Küche benötigt.
Trotz der vielen Arbeit hatte die Gruppe die Möglichkeit, enger zusammenzuwachsen, beim Essen und in den Pause wurde viel gelacht. Dieser starke Zusammenhalt lässt sich auch auf der Bühne sehen, Theater funktioniert eben nur, wenn Vertrauen und Zusammenarbeit stimmen. Rückblickend waren die Theatertage nicht nur eine Vorbereitung auf die Aufführungen, sondern auch eine Erfahrung, die die Gruppe nachhaltig positiv geprägt hat.
Am Ende der drei Tage waren alle müde, aber auch zufrieden und stolz. „Auerhaus“ hatte sichtbar an Struktur gewonnen, ebenso ist die Orga ein beachtliches Stück weitergekommen. Die Theatertage haben gezeigt, wie viel durch richtige Zusammenarbeit und genug Kaffee in so einer kurzen Zeit möglich ist. Die Theatergruppe blickt nun gespannt und motiviert auf die nächsten Wochen und vor allem auf die Aufführungen. Seid dabei!
25. und 26. März: AUERHAUS
Text: Julia Maletzky