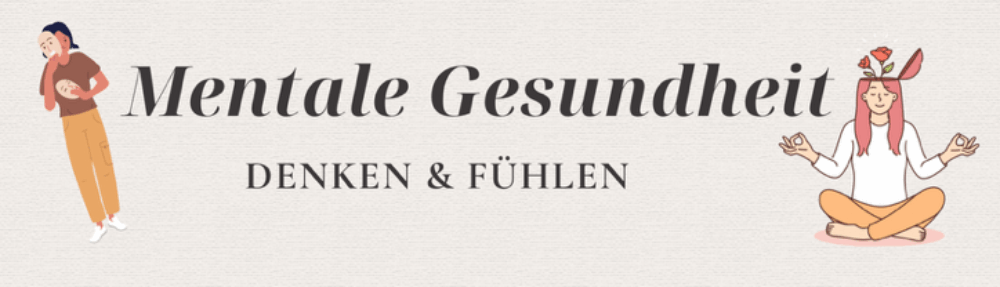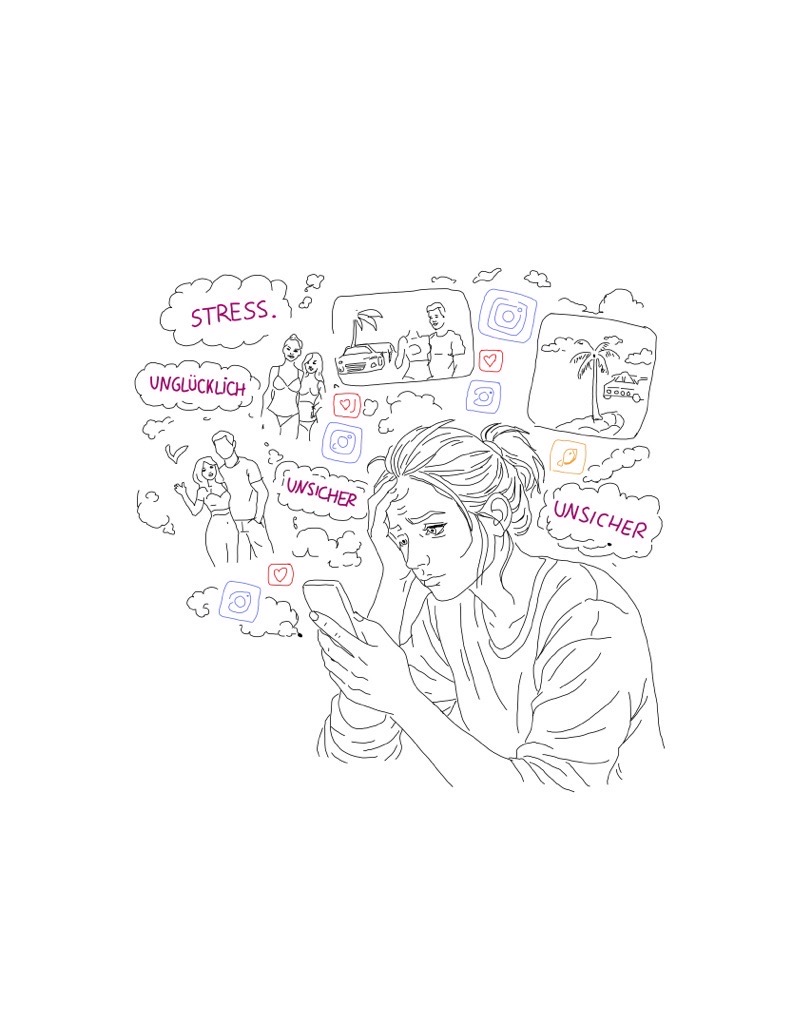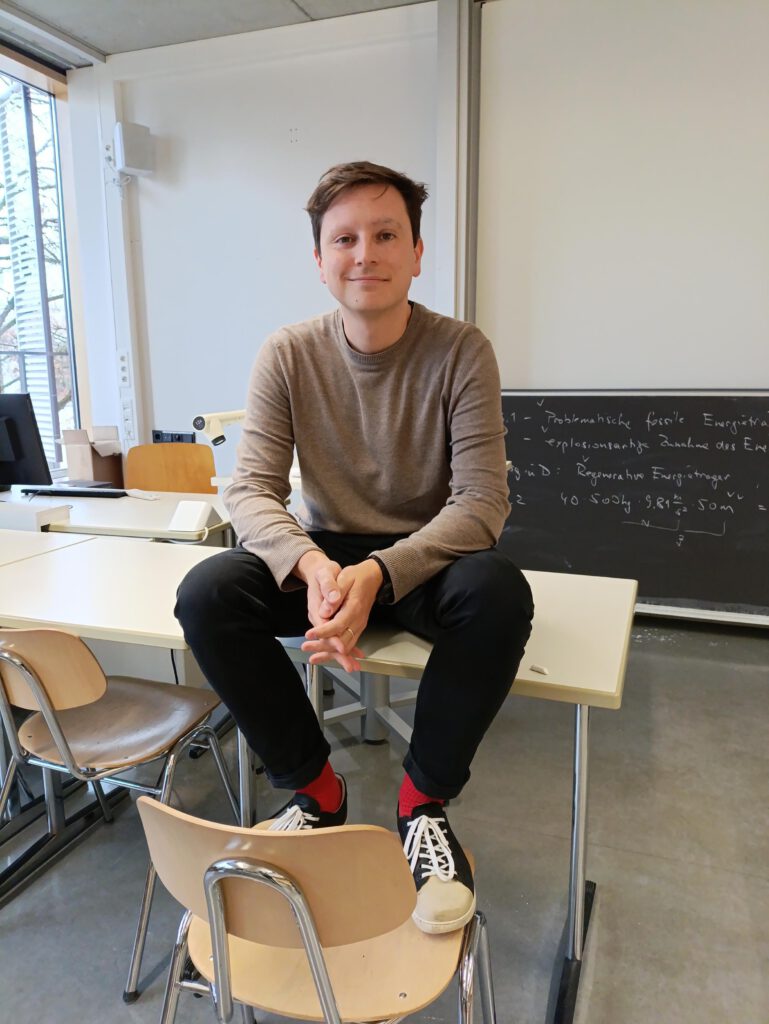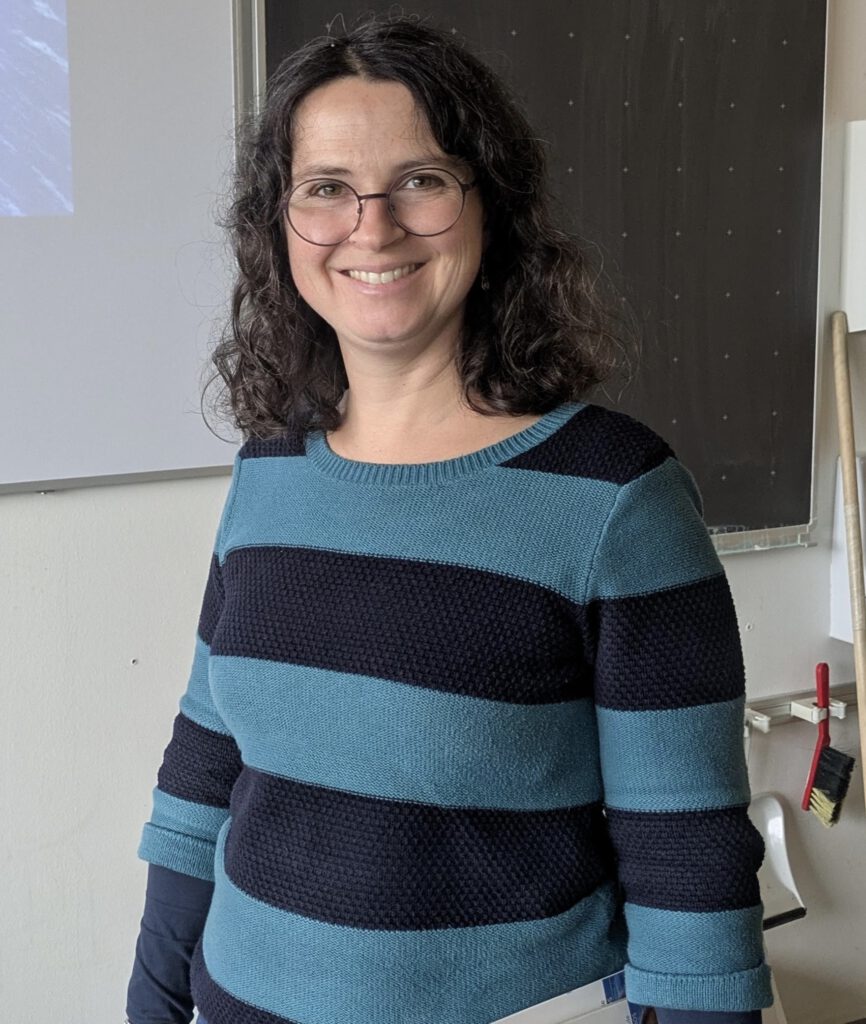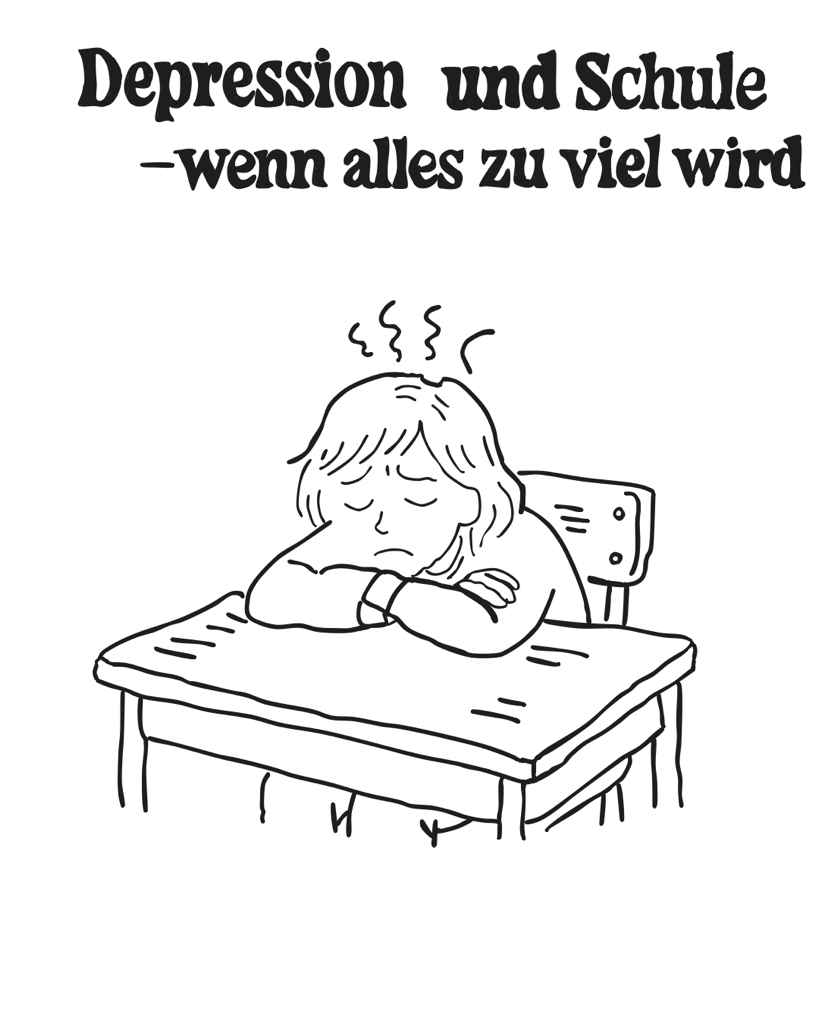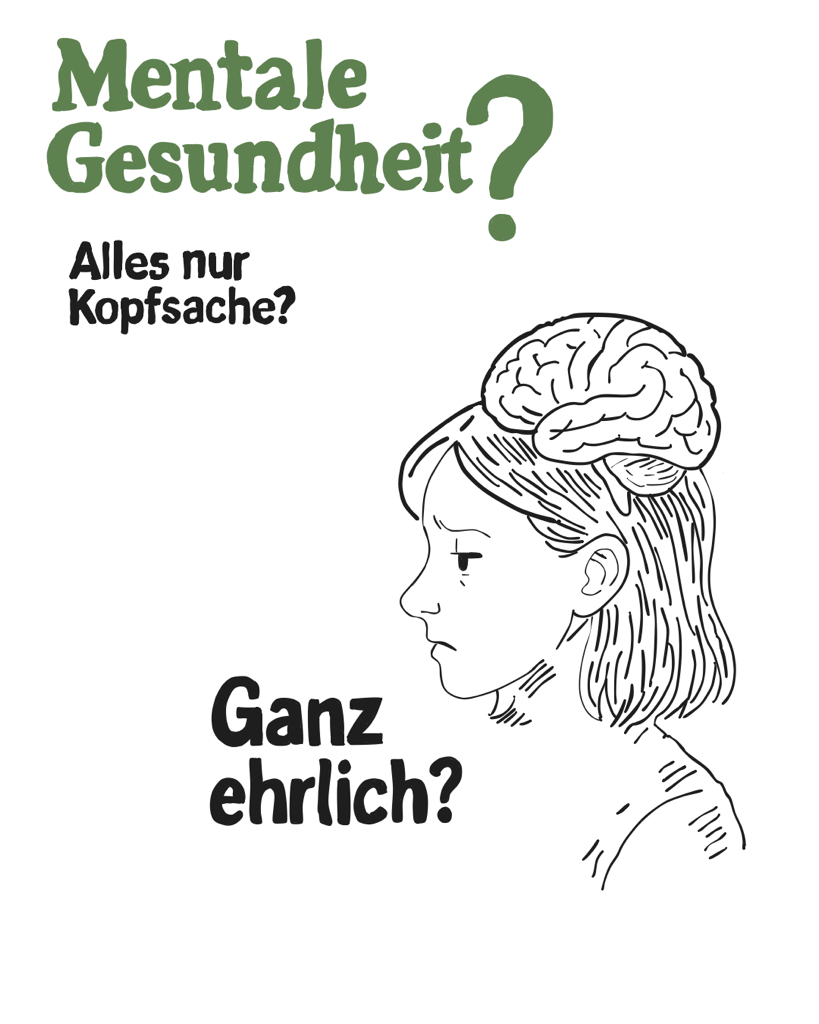Viele kennen das Gefühl: eine wichtige Arbeit steht an und man denkt, je länger man lernt, desto sicherer wird man. Also wird stundenlang durchgearbeitet – manchmal ohne richtig zu essen, ohne zu trinken oder überhaupt aufzustehen. Klingt fleißig, aber für unser Gehirn ist das ein echter Nachteil.
Beim Lernen kommen ständig neue Informationen auf uns zu. Unser Gehirn muss sie sortieren, einordnen und entscheiden, was wichtig genug ist, um im Langzeitgedächtnis gespeichert zu werden. Dieser Prozess passiert nicht während des Lernens, sondern in den Pausen danach. Laut der Universität Zürich fördern Pausen die Verarbeitung und Speicherung neuer Informationen deutlich. Pausen beinhalten also eine Art „Speicherfunktion“: Sie sorgen dafür, dass das, was du gelernt hast, überhaupt hängenbleibt.

Ohne regelmäßige Pausen passiert Folgendes:
- Deine Konzentration nimmt ab.
- Fehlerrate und Vergesslichkeit steigen.
- Du brauchst plötzlich doppelt so lange für dieselbe Aufgabe.
- Und der Stress wächst – oft ohne, dass man es merkt.
Gleichzeitig erfüllen Pausen auch noch einen anderen Zweck: Sie helfen, Stresshormone abzubauen. Schon kurze Pausen, in denen du dich bewegst, frische Luft schnappst oder einfach kurz abschaltest, lassen den Kopf wieder klarer werden. Das bedeutet, dass du danach schneller und entspannter weiterlernen kannst.
Pausen sind also ein aktiver Teil des Lernens – nicht die Unterbrechung davon
Und weil erholtes Lernen viel entspannter abläuft, wirkt sich das direkt auf Prüfungsangst aus. Wer insgesamt ruhiger und strukturierter lernt, geht auch entspannter in die Prüfung.
Genau deshalb folgen jetzt Tipps, die dir helfen sollen, Pausen sinnvoll einzubauen, stressfreier zu lernen und mit mehr Selbstvertrauen in Prüfungen zu starten.
Tipps gegen Prüfungsangst – für gelassenes Lernen & sichere Prüfungen
✔️ 1. Lernstoff in Etappen teilen
Statt alles auf einmal lernen zu wollen, teile den Stoff in kleine Blöcke ein. So bleibt das Lernen überschaubar und du überforderst dich nicht.
Tipp: Plane für jede Stunde 10–15 Minuten Pause ein. Das wirkt wie ein “Reset“-Knopf für den Kopf.
✔️ 2. Effektive Lernmethoden mit festen Pausen nutzen
Viele Schüler arbeiten erfolgreich mit der 50–10-Regel (50 Minuten Lernen, 10 Minuten Pause) oder der Pomodoro-Technik (25 Minuten Lernen, 5 Minuten Pause).
Diese Methoden helfen, konzentriert zu bleiben und verhindern den typischen „Ich sitze seit Stunden hier, aber es bleibt nichts hängen“-Moment.
✔️ 3. Die richtige Atmosphäre schaffen
Aufgeräumter Schreibtisch, Handy weg, etwas zu trinken daneben – schon hast du weniger Ablenkung. Ein sauberer und ordentlicher Arbeitsplatz beruhigt und erhöht die Lernqualität.
✔️ 4. Atemtechniken gegen Nervosität
Wenn du merkst, dass die Anspannung steigt, hilft die 4–4–6-Atmung:
4 Sekunden einatmen → 4 Sekunden halten → 6 Sekunden ausatmen.
Das signalisiert deinem Körper, dass keine Gefahr besteht, und senkt Stress fast sofort.
✔️ 5. Prüfungen „üben“
Bearbeite alte Prüfungen oder setze dir zu Hause einen Timer, um die reale Situation nachzustellen. Je vertrauter dein Gehirn die Situation findet, desto weniger Angst empfindest du in der echten Prüfung.
✔️ 6. Gut zu sich selbst sprechen
Negative Gedanken machen Druck: „Ich schaffe das eh nicht.“ – „Ich kann nichts.“
Versuche, sie bewusst zu ersetzen:
„Ich habe mich vorbereitet.“ – „Ich kann das lernen.“ – „Ich bin fähig.“
Das klingt simpel, hat aber nachweislich großen Einfluss auf die innere Ruhe.
✔️ 7. Gesund bleiben
Genug Schlaf, ausreichend Wasser und Essen mit Energie (Nüsse, Obst, Vollkorn) stärken dein Gehirn. Müdigkeit verstärkt Prüfungsangst – Klarheit verringert sie.
✔️ 8. Blackout? Kurzschreiben hilft!
Falls du in der Prüfung kurz „dicht“ machst, nimm dir 20–30 Sekunden und schreib alles auf, was dir spontan einfällt. Dadurch aktivierst du dein Wissen wieder und bringst Ordnung in die Gedanken.
✔️ 9. Mit anderen sprechen
Es hilft oft, mit Freunden, Eltern oder Lehrkräften über die Angst zu reden. Schon das Aussprechen entlastet und zeigt: Du bist damit nicht allein.
Am Ende lässt sich sagen: Erfolgreiches Lernen hat weniger damit zu tun, wie lange man am Schreibtisch sitzt, sondern wie klug man seine Energie einsetzt. Pausen helfen dem Gehirn, Informationen zu speichern, Stress abzubauen und die Konzentration hochzuhalten. Und wer entspannter lernt, geht auch mit deutlich weniger Prüfungsangst in Klausuren und Präsentationen. Die Tipps in diesem Artikel sollen euch dabei unterstützen, euren eigenen Lernrhythmus zu finden, besser mit Druck umzugehen und selbstbewusster in jede Prüfung zu starten. Ihr müsst nicht perfekt sein – aber ihr könnt lernen, euch selbst etwas Leichtigkeit zurückzugeben. Genau damit fängt erfolgreiches Lernen an.
Text: Lirjona K.