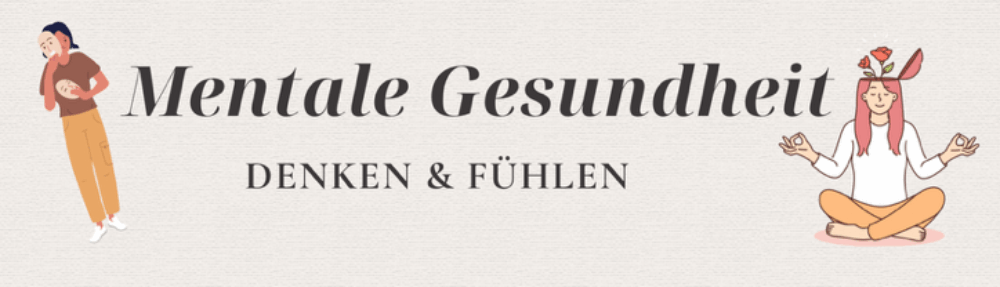»Oh nein, sie ist vegane Feministin! Da muss man ja nicht nur aufpassen, was man sagt, sondern auch, dass man ihr nichts Falsches auf den Teller legt. Wie vorsichtig sollen wir denn noch mit ihr umgehen?«
Das sind Worte, die nicht nur wehtun, sondern auch einen Schritt zurückgehen. Nein falsch, nicht nur einen.
Mehrere.
Unzählige.
Schritte, die uns dahin zurückbringen, wo wir angefangen haben. Als eine Folge der europäischen Aufklärung im späten achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert könnte man meinen, Feminismus wäre kein unberührtes Thema mehr. Klar, wir kennen sie alle. Die #metoo Bewegung vom Herbst zweitausendsiebzehn, den Gender-Pay-Gap (Differenzierung der Gehälter aufgrund des Geschlechts), bis hin zur »Neuen Frau« aus den 20er Jahren. Das Augenrollen und Aufseufzen (oder vielleicht auch Weiterscrollen) bei diesen Aussagen ist schon spürbar. Viele Menschen gehen dem Feminismus aus dem Weg. Oft, weil der traditionelle Weg viel bequemer ist. Und genau deswegen sollten wir noch viel mehr darüber sprechen.
Und ich persönlich lege noch eine Schippe drauf. Denn ich bin vegan – weil ich Feministin bin. Warum das kein Grund zum Weiterscrollen ist, und wieso beides sehr wohl ein Paar Schuhe ergibt, klären wir jetzt.
Veganismus und Feminismus gleicht einander mehr, als man denkt
Die Bestrebung des Veganismus kann man in zwei Punkten zusammenfassen: vermeiden, wofür gelitten wurde und eine Gleichheit schaffen. Diese Ernährungs- und Lebensweise, wie der Veganismus definiert wird, soll also das Machtverhältnis (der Mensch darf das Tier für seinen Genuss ausbeuten) nicht fördern. Ein ähnliches Machtverhältnis versucht der Feminismus zu umgehen. Hierbei achtet man aber auf die Geschlechter. Der Angelpunkt wäre von dem her, dass beispielsweise kein Mann in Bewerbungsgesprächen aufgrund seines Geschlechtes bevorzugt wird. Oder – noch klassischer – mehr verdient, obwohl Frau und Mann dieselben Arbeiten erfüllen.
Eine weitere Parallele ist zwischen den Abzweigungen der beiden „Ämter“ zu erkennen. Im Veganismus möchten die meisten vegan lebenden Menschen denjenigen, die keine Stimme haben, eine geben. Häufig sprechen sie sich (durch beispielsweise Demonstrationen oder durch das Entscheiden für vegane Produkte) für Tierrechte aus. Auch im Feminismus sieht man deutlich, dass die Gleichberechtigung vor allem denjenigen zu Gute kommt, die sonst keine Chance hätten, sich auszusprechen. Der Gender-Pay-Gap, der vielen ein Dorn im Auge ist, wird ebenfalls bei Demonstrationen oder politischen Entscheidungen diskutiert, um vor allem den Frauen die Chance zu geben, sich auszusprechen.
Nun sollte man aber auf keinen Fall denken, Frauen wären unmündig oder verhalten sich wie Tiere. Es geht eher darum, den unterdrückten Parteien Raum zu geben. Menschen, die sexuelle Gewalt erlebten, haben hautnah mitbekommen können, wie die Schärfung dieser Thematik von Jahr zu Jahr zugespitzt worden ist. Auf einmal tauchen mehr Berichte auf, die Strafen steigen, es wird deutlich sensibler damit umgegangen.
Die Milchindustrie – der Grund, wieso jede Feministin vegan sein sollte?
Wenn wir den Kühlschrank öffnen und die selbstverständliche Kuhmilch in den Händen halten, ist uns oft nicht bewusst, was genau wir da eigentlich in den Händen halten. Der ein oder andere würde jetzt die Augenbrauen hochziehen und sich denken: Na klar, weiß ich das! Kuhmilch! Ist doch offensichtlich? Ja, sehr offensichtlich. Aber ist es genauso offensichtlich zu sagen, dass das Eutersekret in deinem Glas das Produkt einer regelrechten Vergewaltigung ist?
Oder andersherum: wann sind Weibchen überhaupt in der Lage dazu, Milch zu geben? Richtig, wenn sie schwanger sind, beziehungsweise Nachwuchs bekommen. Also warten jetzt alle Kuhhalter, die mit der Milch ihre Brötchen verdienen wollen, bis die Kuh sich dazu entscheidet, sich zu paaren? Nö. Die Vergewaltigung ist geplant, einfach und Erfolg versprechend. Die Kuh bekommt nach ungefähr zweihundertachtzig Tagen ein kleines Kälbchen, das sehnsüchtig auf die Milch wartet, um groß und stark zu werden. Was passiert stattdessen? Das Kälbchen wird der Kuh nach der Geburt weggenommen, ein Bulle geschlachtet und ein Weibchen zur Milchkuh herangezüchtet. Und hat die Kuh das Procedere oft genug durchlaufen und ist nicht mehr trächtig zu bekommen, wird sie ein Stück Fleisch auf der nächsten Mittagssemmel. Wunderbar.
Jede Mutter wird mit dem Kopf nicken, dass das ein Alptraum wäre. Vergewaltigung – was ein unglaublich sensibles Thema ist – und dann auch noch das Kind wegnehmen? Niemals. Nicht mit mir? Aber wie willst du dich wehren, wenn du angekettet mit vielen anderen in einem Stall lebst, wo du auf deine eigenen Beine urinierst und wahrscheinlich keinen Platz hast, um dir dieselben Beine zu vertreten (und auch Bio-Milch ist mit den glücklichen Kühen und deren zwei mehr Zentimetern Gras nicht besser!)? Feminismus – die Bewegung der Gleichberechtigung – spricht sich klar gegen solche moralisch verwerflichen Methoden aus. Da kann man doch gleich sagen, dass jede*r Veganer*in gleichzeitig Feminist*in ist?
Wie wirkt das auf Dich: gruselig, übertrieben oder wie der blanke Horror? Ja, dann willkommen in der Realität. Die Realität ist im Veganismus genauso erschreckend wie im Feminismus. Beides scheint ja so verrückt und abnormal, doch sobald man hinter die Kulissen linst, schauen die einen weg, die anderen schlagen die Hand vor den Mund und der Rest zeigt keinerlei Reaktion. Aber egal, wie sehr man versucht, nicht wie ein Moralapostel vor der Türe zu stehen und so lange mit seinen Argumenten zu klingeln, bis das Unwetter einen vertreibt – viele Menschen ändern ihre Meinungen nicht.
Um es zusammenzufassen: es lohnt sich nochmals – vor allem, wenn einem die Gerechtigkeit sehr wichtig ist – hinter den wortwörtlichen Tellerrand zu schauen. Nicht jeder muss von heute auf morgen vegan werden oder auf sonstige Demonstrationen marschieren. Sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, oder klar gegen oder für sie zu sprechen reicht schon. Denn wenn Deine Stimme nicht zählen würde – würdest Du Dir nicht auch jemanden wünschen, der für Dich spricht?
Kommentar von Vanessa S.